|
RONIN NO SHIN
wandernder Geist, wabernde Geistereien, geistige „Sachen“
Meister-Sprüche gibt es für 50 Ct. ab Lager, im Dutzend billiger, in Büchern und Lehrgängen auch teurer.
Inhalt
- Ryu vs Ronin
- Aus Anlaß: Sprüche, Stichworte, Fragmente
- Wie hältst Du es mit dem „Meister“?
- Wie hältst Du es mit dem „Starken Geist“?
- Und die „Tradition“?
- Literatur
- In loser (Gedanken-) Folge
- Isolation, Mutation, Selektion = Evolution
- Ist das (Kampf-) Kunst? Oder kann das weg?
- Aiki-Smerch
- Freizeit-Aikido
- Rituale und Symbole
- Die Frage der Etikette
- Aikido- und Dojo-Modi
- Uke(mi) im Urteil
- Randori und „Flow“
- Über Grenzen
- AAM – “Alternative Aiki-Moves”
Links zu anderen Sites  öffnen im gleichen neuen Fenster
 Tendo-Ryu vs Tendo-Ronin
Tendo-Ryu vs Tendo-Ronin
-
Rōnin (jap.), wörtlich: „Wellenmann“, literarisch: „umherwandernder Mensch“
auch: Rōshi, „umherwandernder Herr/Samurai“
-
Herrenlose japanische Samurai während der Feudalzeit von 1185 bis 1868.
Ein Samurai konnte herrenlos werden, wenn sein Herr starb, vom Shogunat seines Amtes enthoben wurde oder wenn er bei seinem Herrn in Ungnade fiel und verstoßen wurde.
[Quelle(n): Wikipedia Ronin; Wiktionary ronin, shin]
Diese Seite, der Inhalt des ersten Teils dieser Seite, ist aus Irritation entstanden. Es ist eine vermutlich dauerhaft unfertige Meinungs-Seite.
Über „meisterliches“ Tun und Reden, und spiegelbildliches bei der unbedingten und meist japan-reisenden Anhängerschaft
eines Meisters, einer Schule, eines Stils. Deren Position interessiert hier höchstens
in den mildesten und bestgemeinten, wohlwollend gedeuteten – also stärksten und vertretbarsten – Versionen. Weniger in den deutlichen und eindeutigen, vielleicht sektenartigen Seltsamkeiten, die hier nicht weiter vorgeführt werden müssen.
Interessanter ist der Aufbau der Gegenposition: was ist zu bemerken, anzumerken, und dann einzuwenden, bei zuviel an Meister- und Schülerschaft? Wann und wo, womit fängt das an?
In diesem Sinne ist der Titel vom Geist (der Geisteshaltung) des herrenlosen, umherwandernden Menschen, des meisterlosen Aikidoka zu verstehen.
Anlass war schließlich auch eine der üblichen Trennungsgeschichten, weg von einem japanischen Meister, gespaltene Stile und Verbände, von mir und unserer freien Gruppe nur außenstehend beobachtet.
Dann also die Sachen klären, die Menschen stärken, raus aus der Verklärung, aus bekanntlich selbstverschuldeter Unwissenheit und unmündigem Gefolgs-Gehabe.
Und wenn es doch Meister-Autorität braucht, es doch japanisch und traditionell sein soll – wenn schon, denn schon – dann in der Tradition des japanischen Aufklärers: Fukuzawa Yukichi, einem echten Samurai.
Andere (als dieser Aufklärer) reden bzw. irrlichtern vom „starken Geist“, vom „starken (Tendoryu) Aikido“, von der „Stärke“ früherer Japaner.
Damit fing es an: „Pausen“-Vorträge auf Lehrgängen – die doch praktisch/technisch orientiert waren – erklären die (Kampfkunst-) Welt, den Unter- und Überbau von alledem, den Platz eines jeden darin, die damit verknüpften Erwartungen.
Aber die Worte von Stärken und Tugenden sind Leerformeln und Kampfbegriffe. Es geht um Macht und Nachfolge und Interessen. Dazu sind die Begriffe notwendig unbestimmt und wirken unterscheidend.
Ihre Ansprüche können beliebig sein, um Alle und Jeden beliebig dazu gehören oder ausscheiden zu lassen. Wer die Begriffe bestimmt, das System der Werte und Wertungen, bestimmt die Prüfung (z.B. auf Loyalität) und ihr Ergebnis.
Als universelle Geschichte erzählt, japanisch verbrämt: Ein großer alter Shogun bereitet das Feld der Nachfolge. Der Nachfolger ist der junge Waka-Shogun. Das Feld sind die altgedienten Daimyo, die Lokalherrn, die in der Ferne
ihren eigenen Stand, ihr eigenes Können, ihre eigene (Haus-) Macht, und eigene Loyalitäten haben. Weil der Arm des Shogun nicht immer so weit reicht in die Clanterritorien, die Verbände, die Vereine, sind sie gewohnt, die Verhältnisse selbst zu regeln.
Welchen Stand hat dagegen der Waka-Shogun? Wenn dereinst der alte Shogun fehlen wird, auf dessen besondere Beziehung zu ihnen sich die alten Daimyo immer berufen werden: „Der Große Alte“ und „Wir“ hier habe(n) es schon immer / noch nie so / ganz anders gemacht/gemeint; und „Wir“ immer so wie „Er“, „Wir“ waren dabei !
Der alte Shogun, mit der Kraft seiner Autorität, wird also vorher die Daimyo mit ständig neuen Auslegungen und Varianten, Wendungen und Zumutungen prüfen. Die Unbestimmtheit ist dabei ein Mittel, damit sich niemand auf nichts berufen kann, weder jetzt noch später beim Waka-Shogun. Wer alles mitmacht und mit sich machen läßt, wird weiterhin dazugehören und auch dem Waka-Shogun folgen.
Die für loyal befundenen Daimyo werden ihren Erfolg und Verbleib in der Gruppe der (ungefährlichen) Auserwählten als ein besonders inniges Verständnis, als Annäherung an das Unverstehbare umdeuten (vgl. Nihonjinron).
Der Glanz wird auf ihre Schüler abfärben, denn der Shogun wird zu den Daimyo kommen, sie empfangen, sie anhören, sie erhöhen (graduieren), sie vor ihnen ob ihrer Gewissenhaftigkeit und ihres Verständnisses loben. Die (Ge-) Währung symbolischer Handlungen.
Wer von den altgedienten Daimyo sich auf die „im Dienst“ als Gefolgsmann erworbenen Meriten verlässt, auf die Wiederholung der Anerkennung, das Durchregieren und Ignorieren als unangemessen empfindet, muß oder wird gehen.
Gesprächsbedarf wird vom Shogun angemeldet, ein Daimyo wird anreisen, aber Audienz bei Hofe wird nicht gewährt mangels Ehrerbietung; natürlich als ein Mangel innerer „Stärke“ oder Tugend gewertet und unterstellt.
Über Begriff und Funktion der „kokutai“-Ideologie (ca 1988, Hagiwara Yoshihisa)
Die ›kokutai‹-Ideologie hatte aber nicht nur einen unbewußten, sondern auch einen unbestimmten Charakter, denn eine theoretische Fixierung oder Definition von ›kokutai‹ war stets sorgfältig tabuisiert. Diese Tabuisierung hat der kokutai-Ideologie eine doppelt verstärkte ideologische Kraft gegeben. Defensiv bekam sie eine Kritikimmunität, weil der Kern dieser Ideologie immer unklar und schwer begreifbar blieb, und offensiv konnte sie alle Regimekritiker mit der Brandmarkung des ›anti-kokutai‹ als Feinde des Volks unterdrücken. Man wußte nicht, was ›kokutai‹ sei, aber schien zu wissen, was gegen ›kokutai‹ sei !
[…] jedoch besteht sie, genau betrachtet, aus einem immer zweideutigen, fast inhaltslosen Dogma und so vielen Interpretationsmöglichkeiten, daß man beliebige, oft einander widersprechende Positionen von dieser Idee ableiten kann. Das besagt, daß diese Ideologie nichts anderes als ein System der ›Leerformeln‹ ist, die von Topitsch folgendermaßen beschrieben werden: „Jede (Gruppe) behauptet, sie und nur sie erfasse den ›wahren Sinn‹ jener Ausdrücke. Es kommt zu einer Art Wettstreit um die – gar nicht existierende – ›wahre Bedeutung‹ der Leerformeln, wobei der geschichtliche Erfolg darüber entscheidet, welche der kämpfenden Gruppen ihre Auffassung durchsetzen kann.“ „Aber gerade insoferne sie das Pathos der ›Absolutheit‹ mit praktisch unbeschränkter Manipulierbarkeit verbanden, errangen diese Formeln ihren weltgeschichtlichen Erfolg.“ Diese Leerformeln „können auch durch ihren stets gleichbleibenden Wortlaut eine Konstanz der obersten moralisch-politischen Prinzipien vortäuschen, während sie in Wirklichkeit mit jeder möglichen normativen Ordnung und praktischen Entscheidung vereinbar sind.“
Aufklärung ist hier eine Kritik der Begriffe und ihres Gebrauchs. Ein Hinweis auf ideologische Subtexte und Funktionen, der
den Begriffen durch ihre Geschichte anhaftet, auf das mehr oder weniger durch ihren Gebrauch verschleierte Tun.
Man sollte in diesen Dingen vielleicht gute Absichten unterstellen und wohlwollend sein, aber nicht naiv.
Das „Gute“ hat gleich mehrere Gegenteile und Feinde: gut gemeint, eigentlich gut, des Guten zuviel, das Böse oder Schlechte(re), und das Bessere.
 Aus Anlaß: Sprüche, Stichworte, Fragmente
Aus Anlaß: Sprüche, Stichworte, Fragmente
Shimizu Kenji: Festschrift 2009 (p. 5)
Tendo – the way of heaven, is the way to heaven, is the way to the truth.
Tendo means sincerity[†], and only when sincerity can achieved in the way
of one’s living, we can improve ourselves.
Within the Tendoryu Aikido this spirit is the basis of our teachings.
Not to compete with others but to overcome oneself is the basis of our
training. To make Tendo one’s own we have to train sincerely from
morning to evening. Sincerity manifests itself in the spirit of continuous
training. To overcome oneself is the core of this practice. [*]
[*] PDF 3,8 MB (p. 6)
[†] Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Lauterkeit, Echtheit, Wahrhaftigkeit
makoto im jap. Original, i.e. eine der sieben Bushido-Tugenden; aber cf. G.B. (2009)
Shimizu Kenji: Kawaraban (Rundschriften, 1990 ff.) u.a. …
Bushido, The Soul of Japan. ¹1900, ¹³1908 (Nitobe Inazō, 1862–1933,  ) […] ) […]
Death, Honor and Loyalty: the Bushido Ideal (G. Cameron Hurst III, 1941–2016)
In almost every way imaginable, Nitobe was the least qualified Japanese of his age to have been informing anyone of Japan’s history and culture. (…)
Indeed, Nitobe Bushidó: The Soul of Japan became not only an international bestseller, but served as the cornerstone for the construction of an edifice of ultranationalism that led Japan down the path to a war she could not win. (…)
No work of Nitobe’s has been more highly acclaimed than his 1899 “classic,” Bushidó, yet it is perhaps the most misleading of all his writings. (…)
Thus Nitobe’s contemporary, Basil Hall Chamberlain – who was virtually the only one with courage enough to challenge him at the time – was not incorrect when he referred to the excitement over Nitobe’s bushidó as the “invention of a new religion.”
 Wie hältst Du es mit dem „Meister“?
Wie hältst Du es mit dem „Meister“?
Um eine Antwort auf die einleitende Frage gleich zu geben:
siehe nicht nur was er zeigt, höre auch was er sagt (wenn er denn etwas sagt)
– und sei dabei im Geiste so wach und skeptisch, wie auch sonst erforderlich. Sapere aude, incipe !
Einem Meister gebührt ein Vertrauensvorschuß über den richtigen Weg, seine Kampfkunst zu lernen.
Anfangs gibt es für Schüler wenig zu verstehen, und für Meister wenig zu erklären.
Ein Schüler fragt nicht nur falsch, oder stellt falsch in Frage, er versteht
auch die Antworten und Übungen nicht. Das ist die Erfahrung, sobald man selbst lehrt.
Alles erschließt sich mit der Übung, und der Weg ist gangbar auch
ohne Verstehen, wenn man nur ausdauernd übt. Soviel Vertrauen in den Meister, der weiter „fortgeschritten“ ist und Fähigkeiten und Verständnis vorführt, sollte vorhanden sein.
Es nützt schon dem Fortkommen und führt zum Ziel, und „Nutzen“ und „Ziel“ sind sowieso Mißverständnisse.
Ostasiatisches Lernen im klassischen Meister-Schüler-Verhältnis besteht im „Innewerden“ durch akribisches und beharrliches Nachahmen.
Deshalb erklären viele Meister nicht(s), sondern führen (bzw. leben) immer nur wieder erneut vor. Sehen-Können und Machen-Können schulen sich gegenseitig.
Warum manches so ist wie jetzt gerade gezeigt und sonst anders in vielen Varianten, wird zunehmend als selbsterklärend erlebt.
Was ein Meister lehren will, das lebt er auch, da es darin keinen Widerspruch geben kann – theoretisch, bei einem idealtypischen „wahren“ Meister.
Dauerhafte Teilnahme und Teilhabe am Training wird die Schüler dahingehend konditionieren, alles andere auszublenden und dies als Verständnis („Innehaben“) zu verstehen.
Das Sushi-Examen [*]
Japan will die Qualität seiner Küche weltweit sichern und führt eine Art schwarzen Gürtel für Meisterköche ein
Ein Sushi-Chef muss mindestens fünf Jahre lernen, bevor er vor den Augen des Gastes Fisch zerlegen, ... darf. In anderen Restaurants der traditionellen japanischen Küche, Washoku genannt, dauert die Lehre noch länger. (...)
Dass ein Koch so lange lernen muss, liegt eher an der Art, wie Japan Leute ausbildet, als an der Schwierigkeit des Handwerks. Ein Meister erklärt nicht, er macht. Der Schüler soll genau nachmachen, was er vormacht. Endlos, oft harsch wird er korrigiert. Fisch wird nur nach einer bestimmten Technik zerlegt. Die Frage nach dem Warum wäre eine Frechheit.
Japan ist eine theatralische Gesellschaft, die Japaner schlüpfen stets in Rollen, von denen sie genau wissen, wie sie gespielt werden müssen. Es gibt nur eine Art, das Messer zu halten oder den Gästen „Irasshaimase“ zuzurufen: willkommen. Es ist auch festgelegt, welche Zutaten zueinander passen, und in welcher Jahreszeit sie serviert werden. Mit den Dan-Prüfungen soll sich diese Orthodoxie international durchsetzen. (...)
[*] Christoph Neidhart, Süddeutsche Zeitung (SZ) #151, Jg.71, S.1, Sa./So. 4./5. Juli 2015
Wie also kommt ein Schüler durch die Anfänge des Aikido? In erster Linie mit genauer Imitation des Gezeigten und Verzicht auf gängige Vorstellungen.
-
Abzulegen gilt „es wieder mal so wie schon immer zu machen“, obwohl doch anders gezeigt, wenn man nur genau hingeschaut hätte.
Will ich hier lernen ? Will ich hier lernen ? – Schwieriger als Neues zu lernen, ist etwas neu zu lernen.
-
Abzulegen gilt „jetzt mal kämpfen zu lernen“. Wer, wenn es hoch kommt, zweimal die Woche je 90 Minuten übt, kommt auf 12 Stunden im Monat.
– Wer glaubt, mit soviel Eifer und Ausdauer einen ernsthaften Kampf schadlos zu überstehen?
-
Abzulegen gilt „es jetzt mal wissen zu wollen“ ob die gerade geübte Technik auch wirklich geht und dem Angriff
wirksam begegnet. Oder umgekehrt, ob der Angriff nicht doch „durchkommt“, wenn er nur aggressiv und realistisch genug ausgeführt wird.
– Es gibt nicht einen Trick für einen Angriff, sondern nur die Summe allen Aikido-Könnens
gegen einen begrenzten Bereich aggressiver Situationen. In denen ein konkreter technischer Angriff
sich vielleicht – durch Aikido möglichst nicht – entfalten kann.
-
Der Angriff aber, der zuerst und immer abzuwehren ist, ist der sehr ernsthafte und reale Angriff der Trainings-Trägheit.
Warum darüber reden? Warum mühen sich selbst japanische Meister, darüber zu reden (alle anderen sowieso gerne und viel)?
Wenn Meister sprechen, wird es schwierig. Was will uns ein Meister damit sagen,
wenn er – über Aikido im Allgemeinen philosophierend – z.B. einen besonderen Geist anmahnt, in dem geübt werden soll?
- Weil der Übende dann technische und mentale Grenzen überwinden und Steigerungen seines Könnens erleben kann, die
auch der Meister erfahren hat. Und die er schließlich, mit heute wohl nötigem Mahnruf an den „Geist“, erfahrbar machen will für seine Schüler, die durch ihr
unerfahren nachlässiges Training diese Möglichkeiten nicht erkennen und dann auch nicht erreichen können.
- Weil vorher, bei natürlich nicht vorhandenem Vorverständnis, die Vermittlung eines Kampfkunst-Weges so schwierig ist
und oft auf kulturelle Unterschiede trifft. Auf populäre Vorstellungen, was Kampfkünste über den rein sportlich-technischen Teil hinaus
noch alles „leisten“ sollen. Das wäre, in westlichen Worten, ein hermeneutischer Grund: der Zirkel des Verstehens bzw. Innewerdens.
- Weil sich die Bedingungen und Motive, unter denen Kampfkunst einst praktiziert und vermittelt wurde, mehrfach völlig
von den Absichten und Bedingungen ihrer (Wieder-) Begründer entfernt haben. Das ist gesellschaftlicher Wandel, und ist umso drastischer, je weiter entfernt man „einst“ ansetzt.
Er findet auch in Japan, bei japanischen Schülern und in japanischen Dojo statt, und wird von japanischen Meistern eben manchmal schmerzlich bemerkt.
Starker Geist (“Spirit”), als Sammelbegriff für Budo-, Samurai- und Shinto-Tugenden, meint
dabei meist eine Haltung besonders gewissenhafter Hingabe an diese Tugenden. Zum Zwecke
eines Eifers im Training, der im Gegensatz zum bloßen äußeren Abspulen der Trainings-Techniken die Grenzen zum
Innewerden von Techniken und Tugenden überwindet.
Das kann sogar zu weniger körperlicher Übung führen, weil man sinnvoller („effektiver“, durchdringender) übt.
Im Nachhinein, im (zirkelhaften) Begehen des Weges, wird wiederum die Bedeutung der Tugenden und ihre Einheit mit den Techniken erfahrbar.
So die Theorie (andernorts die Praxis), so bekommen das Training und der Trainings-Ort einen umfassenderen, vielleicht sogar spirituellen Sinn – wenn man das will.
Meister mögen nun für ihre Kampfkunst berufen sein, nicht aber unbedingt für die quellenkritische Deutung derer Geschichte und Grundlagen.
Darin sind sie ebenso befangene und (un-) fähige Menschen ihrer und unserer Zeit wie wir alle.
Deshalb wird häufig „belegt“ mit Ausflügen in die Steinbrüche der Historie, auf der Suche nach illustrierenden Beispielen.
Heraus kommt nur sog. „anekdotische Evidenz“ von begrenztem Wert.
Umso mehr gilt es, den Kopf aus dem (pseudo-) philosophischen Nebel heraus zu bekommen, der die Kampfkünste umwabert.
Gleiches gilt für ihre Selbstdarstellungen, also wie sich die Kampfkünste ihre eigene Geschichte wünschen, erzählen und schreiben.
 Wie hältst Du es mit dem „Starken Geist“?
Wie hältst Du es mit dem „Starken Geist“?
Was sich gerne „Philosophie des Aikido“ nennt – ein dünner Firnis –
speist sich aus etwa zwei Quellen: Bushido und Shinto.
Genauer vielleicht: aus einer Verklärung des Bushido und einer Sekte des Shinto.
Wer immer sich zu einer Verteidigung des philosophischen Gehalts und pädagogischen Wertes einer
Kampfkunst aufmacht, begibt sich auf gefährliches und gefährdetes Gebiet. Gefährlich, weil
Begriffe und Inhalte eine ambivalente Geschichte haben. Gefährdet, weil begrifflicher Rest-Bestand
und inhaltliche Relevanz nicht unbedingt intellektuelle Ausflüge nach Ostasien rechtfertigen.
Nicht nur Kampfkunst macht noch nicht zum besseren Menschen,
Samurai-Kodex, Budo-Ethik, und Shinto-Geist tun es auch nicht ohne weiteres.
Zen-Buddhismus mag Budo-Geist inspiriert und Bushi-Jutsu zu Bu-Do gewandelt haben,
letztlich bleibt es doch Produkt und Beschäftigung einer untergegangenen Kriegerkaste.
Zum „Do“ geadelte Kunstfertigkeiten waren ein elitäres Standes-Vergnügen bewaffneter Kleinadeliger
– im erzwungenen Frieden ein Ersatz für das Kriegshandwerk, der zwar „pazifizieren“, letztlich aber auch die Kriegertugenden konservieren sollte.
Ein erzieherischer Wert für heutige Umstände ist und wird überschätzt.
Weder hängt heute unser Leben von unseren Kampftechniken ab, weshalb wir sie wie Samurai ausgiebig üben müssten.
Noch tragen wir unsere Konflikte in einem Werte-, Tugend- und Ehrensystem aus, in dem wir wie Samurai handeln (u.a. kämpfen) müssten.
Noch leben wir in einem Ständesystem, das uns wie Samurai privilegiert (u.a. bezahlt und ernährt) und so zu angemessenen Kampfes-Übungen freistellen könnte.
Ohne den Stand muß sich niemand mehr durch die Reihe von Fähigkeiten definieren, darunter z.B. „kämpfen können“, und seine Zugehörigkeit belegen, z.B. durch „kämpfen müssen“ gegen bestimmte Zumutungen, die das in Frage stellen könnten.
Das machen heute auf je andere Weise Militär und Polizei, die dafür auch die wertvollen Mittel („Schwert“ und „Rüstung“, Gewaltmonopol und Legitimation, Einkommen) gestellt bekommen, wie früher eben auch die Samurai.
Abraham Lincoln (zugeschrieben)
“You may fool all the people some of the time; you can even fool some of the people all the time; but you cannot fool all of the people all the time.” – „Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen, und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen.“ [Man kann manchmal alle(s) und einige(s) immer …, aber nicht immer alle(s).]
Um diesen Aphorismus abzuwandeln:
„Starker Geist“ (unbedingte Treue, Selbstzucht, Willenskraft, Leidensfähigkeit, z.T. Todesverachtung …)
kann manchmal einige (materielle, physische) Grenzen überwinden, aber nicht immer alle.
Der Mythos vom Willen, der das Haben und Können ausgleicht oder gar übersteigt,
ist auch ein Weg („Do“?) der Durchhalte-Ideologie. Gleicher Geist hat schon ethische Grenzen überwunden.
In welchen Zusammenhängen sie entstanden sein mögen und mit welchen Gründen und Deutungen sie (heute) angeführt werden: geschichtliche Beispiele,
in denen individuell oder kollektiv angeblich mit Starkem Geist Leistungen erbracht und damit Erwartungen übertroffen wurden, haben auch Gegenbeispiele
des Scheiterns. Oder des nachträglichen Wunsches, der Geist wäre wegen seiner Taten und Folgen besser weniger „stark“ gewesen.
Schwärmerischer Geist steht am Ende des Weges, der im mildesten Fall nicht erkennt,
daß auch im modernen Japan „Samurai“ (wie „Geisha“ usw.) Erinnerungsorte
und Bilder erst der politischen, dann der populären Kultur sind. Gedankengut, das der Wirklichkeit einer feudalen Ständegesellschaft entstammt
und dort seine Funktion hatte, hat in einer modernen Gesellschaft einen anderen Stellenwert.
Bushidó or Bull? (Karl F. Friday)
The concept of a code of conduct for the samurai was a product of the
seventeenth and eighteenth centuries, when Japan was at peace, not the medieval “Age of the Country at War.”
The samurai of this later period were bureaucrats and administrators, not fighting men;
the motivation held in common by all those who wrote on the “way of the warrior”
was a search for the proper role of a warrior class in a world without war.
The ideas that developed out of this search owed very little to the behavioral norms
of the warriors of earlier times.
[…]
One of the few things that all of these men [who wrote about the idea of a code of conduct for samurai]
had in common was their interest in defining – and defending – the essence of what set the samurai
apart from all other classes.
They were describing – or prescribing – a code of conduct for an elite;
and they were arguing that it was adherence to this code of conduct and the values on which it was based
that separated this elite class of warriors from the rabble of townsmen and peasants behind them.
The idea that bushidó values were simply Japanese values would have appalled them.
[…]
The connection of the Imperial Army to bushidó and the samurai tradition was … an important part
of the modern state’s early propaganda and remained a favorite theme of Japanese militarists and
right-wing essayists right up to Japan’s defeat in 1945.
[…]
Modern bushidó is closely bound up with the notion of a Japanese “national essence,”
and with those of the kokutai, or Japanese national structure, and the cult of the emperor.
It was a propaganda tool, consciously shaped and manipulated as part of the effort to forge a unified,
modern nation out of a fundamentally feudal society, and to build a modern national military
made up of conscripts from all tiers of society.
Bushidó was believed to represent much more than just the ethic of the feudal warrior class.
The Imperial Rescript to the Military of 1882 proclaimed that it
“should be viewed as the reflection of the whole of the subjects of Japan.”
That is to say, warrior values were held to be the essence of Japanese-ness itself,
unifying traits of character common to all classes.
The abolition of the samurai class thus marked not the end of bushidó,
but the point of its spread to the whole of the Japanese population.
Zusammenfassend: Es gab
das praktizierte Bushidô (besser vielleicht bushi-jutsu) der Sengoku-Zeit der streitenden Reiche,
das kodifizierte Bushidô einzelner lokaler Clans (Han) der Edo/Tokugawa-Zeit,
das propagierte Bushidô der Meiji- bis frühen Showa-Zeit, und endlich
das popularisierte Bushidô der Medien der Nachkriegs-Zeit.
[cf. ]
Wer also heute Bushidô oder Budô für (s)eine Kampfkunst in Anspruch nimmt – in welcher
Art und zu welchem Zweck? – sollte wissen, auf welches er sich bezieht und welches
die Quelle seiner eigenen Kenntnisse ist. Was sind die Inhalte, wie war der Gebrauch, wie
haben sich die Bedingungen und Betreiber („Budoka“) geändert?
Death, Honor and Loyalty: the Bushido Ideal (G. Cameron Hurst III, 1941–2016) […]
EJMAS Chronology (History 1900–1939)
Ueshiba Morihei opens a small dojo in Tokyo, where he taught aiki budo,
or “The Unified Spirit Style Martial Way.” (…)
With patronage from several leading admirals, Ueshiba’s fame grew,
and during the winter of 1931–1932, Ueshiba moved to a larger eighty tatami
hall in Tokyo. Admiral Takeshita Isamu made the art’s first foreign demonstrations
in the United States in October 1935.
In 1942, Ueshiba moved his school to a seventeen-acre farm in Ibaragi prefecture.
At the Ibaragi farm, Ueshiba renamed his style aikido, a name meaning the
“Way of the Mind and Spirit in Harmony.” According to Ueshiba, this was
because the martial arts were meant “to nourish life and foster peace,
love and respect, not to blast the world to pieces with weapons.”
Curiously, the idea only occurred to Ueshiba after the Japanese Army
decided that people could master Shotokan karate’s groin-kicks faster
than aiki jujutsu’s difficult grips, and therefore dismissed him
from his teaching position … .
The Historical Foundations of Bushido (Karl F. Friday)
Yes, the Japanese government and the Imperial Army and Navy pushed
the notion of “bushido” as a way to foster the sort of military spirit
they desired from their soldiers and sailors. But no, the code they preached did not
have much to do with anything the samurai believed in or practiced.
The connection between Japan’s modern and premodern military traditions is
thin – it is certainly nowhere near as strong or direct as government propagandists,
militarists, Imperial Army officers, and some post-war historians have wished to believe.
Erst im 20. Jahrhundert redete die Propaganda – zuerst die militärische,
dann die ökonomische – den Japanern ein, sie seien alle Samurai. Was damals schon
Unsinn (in Bezug auf die Quellen) mit manipulativer Absicht und bedenklichen Folgen war, muß heute
für westliche Kampfsinnsucher nicht sinnvoller sein.
Ein Zurück zu einem (nie gewesenen) „Original“-Bushidô kann es nicht geben, für niemanden.
Die nur dünne Verbindung ins Nirgendwo seiner Vergangenheit und die Nachkriegs-Zäsur in die Gegenwart
entbinden aber nicht von der Frage, welche heutigen Sehnsüchte Bushido erfüllen soll.
The Invention of a New Religion, 1912 (Basil Hall Chamberlain, 1850–1935,  ) )
As for Bushido, so modern a thing is it that neither Kaempfer, Siebold,
Satow, nor Rein – all men knowing their Japan by heart –
ever once allude to it in their voluminous writings. The cause of their
silence is not far to seek: Bushido was unknown until a decade or two
ago! THE VERY WORD APPEARS IN NO DICTIONARY, NATIVE OR FOREIGN, BEFORE
THE YEAR 1900. Chivalrous individuals of course existed in Japan, as in
all countries at every period; but Bushido, as an institution or a code
of rules, has never existed. The accounts given of it have been
fabricated out of whole cloth, chiefly for foreign consumption. An
analysis of medieval Japanese history shows that the great feudal
houses, so far from displaying an excessive idealism in the matter of
fealty to one emperor, one lord, or one party, had evolved the eminently
practical plan of letting their different members take different sides,
so that the family as a whole might come out as winner in any event,
and thus avoid the confiscation of its lands. […]
Thus, within the space of a short lifetime, the new Japanese religion of
loyalty and patriotism has emerged into the light of day. The feats
accomplished during the late war with Russia show that the simple ideal
which it offers is capable of inspiring great deeds. From a certain
point of view the nation may be congratulated on its new possession.
Aus nachvollziehbaren Gründen – Budô hat heute eine ganz andere gesellschaftliche Einbettung und Funktion,
eine gewandelte Bedeutung – sind wir heute alle Freizeit-Budôka. Es wird weniger geübt,
die Minder-Übung nimmt folglich weniger Einfluß (d.h. geistig prägende Wirkung) auf unser übriges Leben,
und dies wiederum wirkt auf unsere Art des Übens zurück (eben gemäß seines heute geringeren Stellenwertes).
Um so absurder, wenn mehr unreflektierte (dafür rigorose?) Budô-Ideologie und Japan-Imitation dies ausgleichen soll:
um ein „freischwebendes“ Ideal, ein populäres Konstrukt, zu verwirklichen.
Zwischenruf: Schön und gut, die ganze Kritik und Skepsis hier. Aber was und wo ist Dein „Weg“?
Man kann dem Fehlen, dem Mangel von „Etwas“ (Budô) nicht einfach nur mit dem Ruf nach „Mehr von Diesem“ begegnen.
Das geht an den geschilderten Ursachen des Schwindens vorbei, an dem gesellschaftlichen Wandel, dem geänderten persönlichen Stellenwert.
Budô ist anachronistisch, aus der (Jetzt-) Zeit gefallen. Es wird, wie Aikido und Kampfkünste allgemein und sichtbar meistens an den Meistern selbst,
seinen höheren Ansprüchen nicht gerecht. Es kann sie nicht einlösen, weil schon die Basis, das „Narrativ“, nicht stimmt.
Jeder Sport leistete im Prinzip gleiches, ohne Exotismus, ohne Ritterromantik, ohne Überbau mit heiligem Ernst und großer Gravität, ohne vage Erfüllung von
Sehnsüchten nach „fernöstlicher Ganzheit“ u.dgl.
Budô ist inhaltlich ein heilloses Durcheinander. Natürlich finden sich darin Tugenden und Ideale, denen man in ihrer Allgemeinheit
und Wünschbarkeit schwerlich widersprechen kann. Aber braucht es dafür eine am Budô ausgerichtete Kampfkunst?
Muß umgekehrt eine Kampfkunst, um theoretisch korrekt oder praktisch richtig zu sein, in einen Rahmen wie Budô eingebettet sein?
Jeder kann in Budô hinein- oder herauslesen, was ihm beliebt; mehr oder weniger. Wenn weniger, dann ist es nicht zu unterscheiden
von den sozial attraktiven Wirkungen jeden Sports. Es nennt sich dort Sportsmanship. Wenn mehr, sollte man auch über mögliche unerwünschte Nebenwirkungen sprechen,
über Angemessenheit in modernen (nicht-japanischen) Gegebenheiten, über modernes Menschenbild und das Leben
in widersprüchlichen Anforderungen und zerteilten Wirklichkeiten. Was soll Budô hier erfüllen, bewirken oder gar verbessern?
In der großen diffusen Gemengelage, die Budô ist, stecken viele japanische Sozial-, Rollen- und Verhaltensmodelle, unklare Quellen und Begriffe, erfundene Traditionen, mit historisch ambivalenten Funktionen und Interpretationen.
Japanische Erinnerungsorte, die auf- und abgeklärt gehörten. Die hier auf eine „westliche“ Form des Umgangs mit eigenen Entfremdungen und Entsagungen im Zuge der Moderne treffen (Eskapismus/Exotismus), die zu westlichen Sehnsuchtsorten werden.
 Und die „Tradition“?
Und die „Tradition“?
Fukuō-Jiden, 1899 (S. 150 f.) [*]
Unsere Gesellschaft leistete sich Fehler und Mißverständnisse am
laufenden Band. (…) Bei anderer Gelegenheit begab sich einer der
drei Gesandten auf das Klosett, wobei ihn ein Diener mit einer
Traglaterne begleitete [†]. Die Doppeltür des Klosettes war in aller
Weite offen und davor hielt der Diener in feinster Kleidung, die
beiden Schwerter seines Herrn in der Hand, treue Wacht, während sein Herr
auf japanische Art seine Not verrichtete. Diese Szene spielte sich auf
einem der belebtesten Gänge des Hotels ab im Schein von hellen
Gaslaternen. Ich kam gerade dort vorbei und traute meinen Augen nicht.
Ohne ein Wort zu verlieren, schlug ich die Tür zu und danach klärte ich in
aller Ruhe den guten Vasallen auf.
[*] Siebentes Kapitel: Reise durch Europa. (Japanische Gesandschaft, Hotel de Louvre, Paris 1862)
[†] Anm.d.V.: Traditionsgemäß, hier aber unter neuen „modernen“ Umständen, wie nun folgt.
Die Bushido-Tugenden sind einer traditionalen Gesellschaft mit feudalen
Strukturen entwachsen und später unter anderen Umständen und zu
anderen Zwecken formuliert und instrumentalisiert worden. Dieses
Spätere enthält deswegen weder die tatsächlichen noch die informellen
Verhältnisse seiner Herkunft. Feudale Beziehungen sind mehr als die
Summe ihrer Kodifizierungen. Nicht ein Stand hat Privilegien,
sondern jeder Stand die ihm jeweils eignen, die von den anderen
Ständen geachtet und durch entsprechende Gesten gegenseitig gewürdigt
werden müssen. Jeder Stand hat diese Pflichten neben seinen
Privilegien, und muß den Pflicht-Erwartungen genügen.
Wenn ein Meister nun qua seiner „Privilegien“ von den (Bushido-Tugend-) „Pflichten“
seiner Aikido-Schüler spricht, was und wo sind dann deren Privilegien und seine Pflichten?
Angemessen der heutigen Zeit, welchen Pflicht-Erwartungen muß (w)er genügen?
Fukuō-Jiden, 1899 (S. 276 f.) — Zitat als PDF 41 KB
Mit dem Fall der Shogunatsregierung legte ich auch sofort meinen
Samurairang nieder und meine beiden Schwerter ab. Bald folgten diesem
Beispiel auch andere in meiner Schule. Nun, das Schwertablegen war aber
gar nicht so einfach, obwohl man sich allseits hätte freuen sollen, diese
Mordwaffe loswerden zu können. Das Gegenteil aber war der Fall. Als ich
zum ersten Mal ohne die Schwerter im Gürtel nach Shiodome in die Villa von
Okudaira ging, waren die anderen Clansleute sehr überrascht und einige
beanstandeten mich, daß es eine Unhöflichkeit gegenüber dem Fürsten sei,
ohne Schwerter am Hof zu erscheinen. Ein anderes Mal erlebten Obata
Jinzaburo und einige andere aus der Schule gefahrvolle Minuten, als sie
von einigen radikalen Elementen wegen des Nichttragens von Schwertern
beanstandet wurden. Trotz allem blieb ich meinem Entschluß, die Schwerter
abzulegen, treu und kümmerte mich nicht um das Gerede der anderen. Auch in
der Schule fanden sich Gleichgesinnte, die meine scharfen Worte richtig
fanden: „Wer heute in einer Zeit der Landesöffnung und Zivilisierung noch
freudig mit den alten Mordgeräten herumläuft, ist ein Idiot. Je länger das
Schwert, ein desto größerer ist er. So könnte man die Samuraischwerter als
‚Idiotenmeter‘ bezeichnen.“
Soviel zum Traum vom Alten Japan; diesmal aber von einem echten
Samurai ! Sollte unser herrenloses Dojo jemals einen japanischen
„Meister“ als Vorbild und Bild an der Wand brauchen, wie so
oft üblich, dann vielleicht diesen und jenes folgende …

Fukuzawa Yukichi (25, 1835–1901) mit Theodora Alice Shew (12, 1848–1904) Photostudio von William Shew (1820–1903) in San Francisco 1860
Fukuō-Jiden, 1899 (S. 140 f.) — Bild & Zitat als PDF 77 KB
Nachdem wir in Hawaii Kohlen gebunkert hatten, ging die Fahrt weiter. Da muß ich
eine heitere Episode erwähnen. (…) An dem Tag, an dem wir von
Hawaii ausgelaufen waren, zeigte ich den Leuten auf dem Schiff dieses Photo
hier. [Dabei zog der Erzähler ein Photo hervor und überreichte es dem
Stenographen. Darauf ist Fukuzawa mit einem etwa 15 oder 16 Jahre alten Mädchen
abgebildet.] Natürlich wußten die anderen damals nicht, ob es sich bei dem
Mädchen um eine Animierdame, ein Straßenmädchen oder um eine anständige Tochter
aus gutem Hause handelte.
„Ihr wart alle ziemlich lang in San Franzisko, aber keinem von euch ist es
gelungen, sich mit einem Mädchen zusammen photographieren zu lassen. Ihr redet
den ganzen Tag groß herum von euren Liebesabenteuern, aber es scheint
nicht viel daran zu sein, denn es fehlt euch ja an Beweisen dafür!“ hänselte ich
sie. Das Mädchen war die Tochter eines Photographen. Sie war 15 Jahre alt, wie
sie mir gesagt hatte. An einem regnerischen Tag war ich allein ins Atelier
dieses Mannes gegangen, wo ich zuvor schon einmal gewesen war, und hatte dort
dieses Mädchen getroffen. Ich bat es, sich mit mir zusammen photographieren zu
lassen und sie hatte sofort ihre Zustimmung gegeben. Die jungen Leute auf dem
Schiff waren mächtig erstaunt, als ich ihnen dieses Photo präsentierte, und es
wurmte sie sehr, daß sie es mir nicht mehr nachmachen konnten. Solange wir in
San Franzisko waren, hatte ich nichts davon erwähnt, weil es mir alle anderen
sonst sofort nachgemacht hätten. So hatte ich es erst nach dem Verlassen von
Hawaii, als wir bereits weit von Amerika weg waren, hergezeigt und mich für
einige Zeit über die anderen lustig gemacht.
 Literatur
Literatur
- Klaus Antoni (
 , *1953): , *1953):
-
Kulturgeschichte und traditionelles Wertesystem Japans.
Onlinetext, ca 2006–2012.
Homepage von Prof. Dr. Klaus Antoni. Japanologie, Eberhard Karls Universität Tübingen.
[lokale Kopie (c) K.Antoni: PDF 300 KB]
- Klaus Antoni (
 , *1953): , *1953):
-
Kokutai – Political Shintô from Early-Modern to Contemporary Japan. Open Access Publication (PDF 2,85 MB),
Eberhard Karls Universität Tübingen, Tobias-lib 2016 (422 pages).
Überarbeitete und erweiterte englische Version von „Shintô und die Konzeption des japanischen Nationalwesens (kokutai). Der religiöse Traditionalismus in Neuzeit und Moderne Japans.“ in: Handbuch der Orientalistik Abt. 5, Japan; Bd. 8; 1998.
- David Bender:
-
Sport, Kunst oder Spiritualität?
Eine ethnografische Fallstudie zur Rezeption japanischer budō-Disziplinen in Deutschland,
[Dissertation 2011] Münster et al.: Waxmann Verlag ¹2012. (Mainzer Beiträge zur Kulturanthropologie/Volkskunde, Band 6; 380 Seiten;  )
ISBN 978-3-8309-2698-6. )
ISBN 978-3-8309-2698-6.
- Ruth Benedict (1887–1948):
-
Chrysantheme und Schwert.
Formen der japanischen Kultur,
am. Orig. The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture. NY 1946,
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag ¹2006, dt. Erstausgabe. (edition suhrkamp 2014; 281 Seiten)
ISBN 978-3-518-12014-9.
- Oleg Benesch:
-
Bushido: The Creation of a Martial Ethic/Spirit in Late Meiji Japan.
[local copy (c) O.Benesch: PDF 1,5 MB]
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Graduate Studies (Asian
Studies) of the University of British Columbia (Vancouver) in February
2011 (358 pages).
- Oleg Benesch (
 ): ):
-
Inventing the Way of the Samurai.
Nationalism, Internationalism, and Bushidō in Modern Japan.
Oxford University Press ¹2014 (The Past & Present Book Series),
ISBN 978-0-19-870662-5 (Hardback, 2014, 304 pages), 978-0-19-875425-1 (Paperback, 2016, viii+284 pages).
Inventing the Way of the Samurai examines the development of the ‘way of the samurai’ – bushidō – which is popularly viewed as a defining element of the Japanese national character and even the ‘soul of Japan’. Rather than a continuation of ancient traditions, however, bushidō developed from a search for identity during Japan’s modernization in the late nineteenth century. The former samurai class were widely viewed as a relic of a bygone age in the 1880s, and the first significant discussions of bushidō at the end of the decade were strongly influenced by contemporary European ideals of gentlemen and chivalry. At the same time, Japanese thinkers increasingly looked to their own traditions in search of sources of national identity, and this process accelerated as national confidence grew with military victories over China and Russia.
Inventing the Way of the Samurai considers the people, events, and writings that drove the rapid growth of bushidō, which came to emphasize martial virtues and absolute loyalty to the emperor. In the early twentieth century, bushidō became a core subject in civilian and military education, and was a key ideological pillar supporting the imperial state until its collapse in 1945. The close identification of bushidō with Japanese militarism meant that it was rejected immediately after the war, but different interpretations of bushidō were soon revived by both Japanese and foreign commentators seeking to explain Japan’s past, present, and future. This volume further explores the factors behind the resurgence of bushidō, which has proven resilient through 130 years of dramatic social, political, and cultural change.
Reviews:
Benesch’s history of bushidō as an invented
tradition with an ideological character delivers on the title’s
promise. Students of intellectual history will appreciate the example of
an idea created, branded as tradition, and then variously applied by
multiple ideological positions. Modernists will benefit from
Benesch’s explanation of the Imperialist appropriation of bushidō
as a tool for militarization of the population through World War II. And
Japan specialists are finally armed with a full argument against
bushidō’s historicity. – Nathan H.
Ledbetter, Journal of Military History
- Julian Braun (
 , *1972): , *1972):
-
Der ‚gemeinsame Weg von Schwert und Pinsel‘.
Philosophie und Ethik japanischer Kriegskunst der Tokugawa-Zeit (1603–1868).
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades ‚Doktor der Philosophie‘
an der Fakultät für Kulturwissenschaften der Eberhard Karls-Universität,
Tübingen 2006. (395 Seiten)
Synopsis & Open Access PDF:
Die Arbeit stellt die philosophischen (dô), ethischen (bun) und
kämpferischen (bu) Ideale der Krieger der Tokugawa-Zeit dar. Dies
geschieht anhand der Untersuchung der wichtigsten begrifflichen Konzepte
(mushin, isshin, ji-ri u.a.), welche dem Taoismus, Konfuzianismus und
Buddhismus entlehnt sind. Dabei werden sowohl die Herkunft der Konzepte
und ihre Bedeutung im spezifischen Kontext des Themas, als auch die
Bezüge der drei Bereiche untereinander herausgearbeitet. Der Anhang
enthält die Übersetzung dreier repräsentativer Quellentexte jener Epoche
(Bansenshûkai – Shôshin, Heihô okugi koroku – Onmyô heigen;
Ittôsai-sensei kenpôsho).
- Gerhard Bierwirth (*1943):
-
Bushidō.
Der Weg des Kriegers ist ambivalent. Ein Essay.
München : Iudicium Verlag 2005 (Iaponia Insula, Studien zu Kultur und Gesellschaft Japans, Bd. 15, 154 Seiten),
ISBN 978-3-89129-824-4.
Synopsis:
Bushidō, der Weg des Kriegers, polarisiert. Gegner wie Anhänger sind
seit jeher mit missionarischem Eifer bei der Sache. Ist Bushidō eine Art
Religion? Zumindest ein Religionsersatz, aber auch Theater und Fiktion.
Ausgehend von der „Erfindung“ dieses Religionsersatzes in der
Meiji-Zeit, werden die vielfältigen und widersprüchlichen Aspekte der
„Samurai-Erzählung“ in Japan, aber auch im Ausland analysiert. Dabei
erweist sich der pseudo-religiöse, theatralische und fiktive Bushidō,
jenseits aller Romantisierung und aller Ideologiekritik, als ein
wichtiger Katalysator für die japanische Suche nach Individualität und
Identität. Eine neue, dekonstruktivistische Interpretation der
„Samurai-Erzählung“, vor allem des berüchtigten „Hagakure“ aus dem 18.
Jahrhundert, bisher vor allem bekannt als Lieblingsfibel von
Kamikaze-Piloten, Managern und Kampfkunstanhängern, vermittelt
überraschende Einsichten – „Japan erklären“ kann und will sie nicht.
-
„An dieser Stelle wird deutlich, dass diejenigen, die sich heute
auf die Samurai-Erzählung oder den bushidō beziehen, höchst
unterschiedliche historische Varianten im Auge haben. In einem Falle
gilt der Bezug den mittel|alterlichen Kriegern so wie sie in der
Überlieferung sich darstellen. Im anderen Falle gilt das Interesse der
bushidō-Fiktion der Tokugawa-Zeit, die mit Elementen aus dem
Zen-Buddhismus und Neo-Konfuzianismus angereichert ist. Im dritten Falle
bezieht man sich auf den bushidō der Meiji-Zeit, der bereits ohne bushi
[Krieger] auskommt, womit sich die Fiktionalität des Tokugawa-bushidō um
eine weitere Potenz erhöht. Im letzten Falle schließlich hat man nur
noch die Pervertierung des bushidō im 2. Weltkrieg durch die
Selbstmordkommandos vor Augen.“ (S.81|82, Fn.39)*
-
„Der weitgehend fiktionale bushidō hingegen, den kein vergleichbares Netz
historischer Daten bestimmt, ist gewissermaßen zeitlos und steht damit
als Pseudo-Religion, Inszenierung und Fiktion in Form der
Samurai-Erzählung allen Zeiten und allen gesellschaftlichen Schichten
zur Verfügung. Anders ausgedrückt: Der bushidō ist mehr Bibel als
historische Quelle und seine Interpretation hat mehr mit Theologie als
mit Geschichtswissenschaft zu tun.“ (S.87)*
-
„Liest man, mit dem Meta-Text ... im Kopf, das Budōshohinshū
[Kriegskunst für Anfänger] ... wird sofort deutlich, dass auch dieser
Text keine dem Bürgerlichen entgegengesetzte, anspruchsvolle
Samurai-Ethik, sondern bereits ein Plädoyer für die Einverleibung des
Einzelnen in den Betrieb ist. Individualismus ist hier bereits nur noch
als Disziplinierung des Selbst im Dienste der Gemeinschaft zugelassen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Einverleibung militärisch,
bürokratisch oder kirchlich ist. Die zahllosen Kleider-, Nahrungs-,
Hygiene- und Huldigungsvorschriften religiöser und mutatis
mutandis militärischer Art sind allesamt ähnlich repressiv und
kleinlich und haben allesamt ein ähnliches Ziel: Die Herstellung
konformen Verhaltens sowie eine Verinnerlichung der
Wertvorstellungen ihrer jeweiligen Institution.
Es kann daher nicht wirklich überraschen, dass ... zwischen den
Samurai-Bürokraten der Tokugawa- und Meiji-Zeit, den Soldaten des 2.
Weltkriegs und den Bankangestellten der 60er Jahre eine deutliche
Homologie festzustellen ist. ‚Schwert und
Aktenordner‘, könnte man auch sagen, sind sich hier mindestens so
nahe wie ‚Schwert und Buch‘ oder ‚Schwert und
Zen‘.
Dieser Befund ist wichtig, weil er vor dem Missverständnis
bewahrt, die Samurai-Erzählung nur auf eine Art zu lesen. Er ist
wichtig, weil der die prinzipielle Ambivalenz dieser Erzählung
nochmal unterstreicht und ihre unterschiedlichen
Instrumentalisierungsmöglichkeiten konkret vorführt.
Der Meta-Text ... dekonstruiert als Ganzer den Anspruch des
Budōshohinshū, eine Samurai-Ethik zu liefern, als
bloße Samurai-Etikette und den Überlegenheitsanspruch der Samurai als
bloße Macht der Verwaltung und der Vorschriften. Beide Texte zusammen
dekonstruieren zugleich den romantisierenden bushidō| ...
als theatralische, pseudo-religiöse Fiktion, indem sie
unmissverständlich auf die der Dialektik von Individuum und
Gesellschaft je innewohnende Möglichkeit der Vernichtung von
Individualität verweisen. (...)
Im Grunde ist diese Samurai-Erzählung nicht viel mehr als ein
japanisches Benimm-Buch, das, obwohl es ständig vom Krieger spricht,
nur noch an Etikette und Verhaltensregeln interessiert ist – als
ob diese den Untergang der Kaste aufhalten könnten. Es ist letztlich
nichts anderes als eine bereits vom Bürgerlichen, der Welt der
chōnin [städtische Bürger] infizierte Sammlung von
Regeln für Samurai-Bürokraten, die nicht mehr kämpfen können und
ihre nutzlosen Schwerter jeden Tag nur ins Büro tragen. (...)
Würde man im Budōshohinshū das Wort Krieger
jedes Mal durch das Wort Angestellter ersetzen – es würde sich
nichts ändern.“ (S.102|103)*
-
„In diesen deprimierenden Vorschriften zeigt sich das
Budōshohinshū als adäquater Ausdruck jener
bereits beschriebenen fortschreitenden Formalisierung und
Bürokratisierung menschlicher Beziehungen und trägt den Keim des
Bürgerlichen schon in sich. (...) Der sich modernisierende
bushidō, der sich vom Bürgerlichen absetzten will,
zeigt sich als eben diesem Bürgerlichen schon halb verfallen.|
Lange bevor die Kaste der Samurai abgeschafft wurde, das zeigt diese
Samurai-Erzählung, hat sie sich schon selbst aufgegeben. Das
auffällige Insistieren des Budōshohinshū auf den
Kastenunterschieden und der Überlegenheit der Samurai ist nichts
anderes als der verzweifelte Versuch, das drohende Aufgehen im gemeinen
Volk zu kaschieren. Die hartnäckige Rede vom Krieger und vom
bushidō stellt sich als nichts anderes heraus als das,
was Akutagawa die ‚Mätzchen‘ des bushidō
genannt hat, die der Bürokratie aufgesetzt sind, um dessen Macht zu
legitimieren. Hier hat sich der Schwertadel bereits von allem Edelen,
der Held von allem Heroischen verabschiedet und spielt – im
bürokratischen Milieu – theatralisch nur noch sich selbst.
Im Grunde genommen ist das Budōshohinshū
aus dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts bereits ein Zeugnis der
Dekadenz, ... aus dem aber ... etwas mehr als hundert Jahre später der
‚neue Mensch‘ nicht als instinktgeleitetes unabhängiges
Individuum, sondern als Prototypus des sararīman
[Angestellte] hervorgeht. Dieser Befund kann vermutlich weder die
Romantiker unter den Liebhabern der Samurai-Erzählung noch die
Anhänger der Kampfkünste mit Begeisterung erfüllen.
Daidōji zeigt, wie jeglicher Individualismus durch Formalien,
Strukturen und Gesten zum Verstummen gebracht werden kann. Seine
Samurai-Erzählung zeigt dem Angestellten von heute keine Utopie einer
möglichen Befreiung und Selbstbestimmung, sondern eine ziemlich exakte
Kopie seines eigenen trostlosen, fremdbestimmten Lebens voller
‚Mätzchen‘ und Etikette. Darüber kann auch die
Samurai-Kostümierung nicht mehr hinwegtäuschen. Auch das ist
bushidō.“ (S.108|109)*
[*] Anm. S.U.: Im Essay finden sich diese Aussagen/Zitate im (begrenzenden) Kontext je konkreter Samurai-Erzählungen,
in literaturmethodisch zusammenhängender und gegenseitiger Dekonstruktion von Text und Meta-Text. Das ist vor/bei
Verallgemeinerungen zu berücksichtigen.
— Zitate als PDF 39 KB
- Gerhard Bierwirth (*1943):
-
Makoto und Aufrichtigkeit.
Eine Begriffs- und Diskursgeschichte,
München : Iudicium Verlag 2009 (Iaponia Insula, Studien zu Kultur und Gesellschaft Japans, Bd. 19, 361 Seiten),
ISBN 978-3-89129-828-2.
Synopsis:
Aufrichtigkeit ist eine höchst zweifelhafte Angelegenheit. Sie soll
Vertrauen schaffen und macht doch unverträglich und selbstgerecht. Sie
soll Gemeinschaft fördern und führt doch zu Isolation und
Diskriminierung. Dass sie außerdem keine Tugend ist, die überall und zu
allen Zeiten galt, zeigt der Aufrichtigkeitsdiskurs in Europa, der in
der Renaissance begann und mit der Romantik endete.
Gleichwohl wird makoto häufig mit diesem widersprüchlichen Begriff
übersetzt oder in diesem Sinne verwendet. Dabei hat das makoto des
Neo-Konfuzianismus, des Shintō, der Samurai-Ethik, der haikai-Poetiken
und des bürgerlichen Diskurses selbst viele widersprüchliche
Bedeutungsschichten.
Anstatt zu fragen „Wie aufrichtig sind die Japaner?“, rekonstruiert das
Buch diese Bedeutungsschichten und zeigt, wie westliche
Entwicklungshelfer (o-yatoi) und westliche Texte im Japan der Meiji-Zeit
eine Überkronung von makoto durch den Aufrichtigkeitsbegriff befördert
haben.
Es macht auch deutlich, dass diese Überkronung das Ergebnis eines
Kampfes um die Deutungshoheit von Begriffen und Werten in Japan selbst
war und dass dabei auch traditionelle Lesungen von makoto verändert
wurden.
Das so begriffs- und diskursgeschichtlich rekonstruierte kulturelle
Gebilde makoto mit seinen west-östlichen, bürgerlich-adligen und
pragmatisch-idealistischen Komponenten erweist sich damit als
anschauliches Fallbeispiel für die These kultureller Hybridität und das
Paradigma der Transkulturalität.
- Carol Gluck (*1941):
-
Japan’s Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period.
Studies of the East Asian Institute, Columbia University.
Princeton, NJ : Princeton University Press ¹1985 (Paperback Reprint 1987, 424 pages)
ISBN 978-0-691-00812-7.
Ideology played a momentous role in modern Japanese history. Not only
did the elite of imperial Japan (1890–1945) work hard to influence the
people to “yield as the grasses before the wind,” but historians of
modern Japan later identified these efforts as one of the underlying
pathologies of World War II. Available for the first time in paperback,
this study examines how this ideology evolved. Carol Gluck argues that
the process of formulating and communicating new national values was
less consistent than is usually supposed. By immersing the reader in the
talk and thought of the late Meiji period, Professor Gluck recreates the
diversity of ideological discourse experienced by Japanese of the time.
The result is a new interpretation of the views of politics and the
nation in imperial Japan.
- Ivan Morris (1925–1976):
-
Samurai oder Von der Würde des Scheiterns.
Tragische Helden in der Geschichte Japans,
am. Orig. The Nobility of Failure. Tragic Heroes in the History of Japan. Berkeley 1975,
Frankfurt am Main : Insel Verlag ¹1989, TB 1999. (insel taschenbuch 2515; 591 Seiten)
ISBN 3-458-34215-X.
- William R. Patterson:
-
“Bushido’s Role in the Growth of Pre-World-War-II Japanese Nationalism.”
Orig. in: Journal of Asian Martial Arts ( ),
Vol. 17, No. 3 (2008), pp. 9-21; Digital Edition 2010 (15 pages). ),
Vol. 17, No. 3 (2008), pp. 9-21; Digital Edition 2010 (15 pages).
- Georg Schrott (*1960):
-
Ohne Schwert und ohne Dogma.
Innere Lernprozesse auf dem Weg des Aikidō,
Norderstedt : BoD (Books on Demand) 2015. (316 Seiten)
ISBN 978-3-7347-8452-1.
Synopsis, vier Zen-Doppel-Seiten:
HIER (S.70f.), JETZT (S.140f.), EINS (S.196f.), (S.272f.)
- Stephen Vlastos (Ed., *1943):
-
Mirror of Modernity: Invented Traditions of Modern Japan.
Berkeley : University of California Press 1998. (xvii+328 pages)
ISBN 978-0-520-20637-3.
Synopsis:
This collection of essays challenges the notion that Japan’s
present cultural identity is the simple legacy of its pre-modern and
insular past. Building on the historical analysis of British traditions,
“The Invention of Tradition”, 16 American and Japanese
scholars examine “age-old” Japanese cultural practices,
ranging from judo to labour management, and show these to be largely
creations of the modern era.
- Fukuzawa Yukichi (1835–1901):
-
Eine autobiographische Lebensschilderung.
Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Gerhard Linzbichler,
jap. Orig. Fukuō-Jiden. Tokyo 1899,
Tokyo : Keio-Gijuku-Universität 1971. (387 Seiten)
- Ichizô Matsui (Verf.), Hartmut Lamparth (Hrsg./Übers.):
-
Japanische Etikette.
Ein Handbuch aus dem Jahre 1887,
jap. Orig. Nippon reishiki Ogasawara genryû yôryaku,
Mitteilungen der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens (Sept.1998).
ISBN (ISBN-10) 3-928463-65-9, EAN (ISBN-13) 978-3-928463-65-2 ( ). ).
- Shimizu Kenji, Tendo World Aikido (Ed.):
-
Tendokan 40th anniversary Tendo World Seminar. [Festschrift 2009; PDF 3,8 MB]
International Seminar in Japan (Shimoda : Kannon Onsen; Tokyo : Tendokan), Tendo World Aikido : October 12.–18. 2009.
- etc. et al.:
-
cf. die längere Liste

 In loser (Gedanken-) Folge
In loser (Gedanken-) Folge
Der Anfang einer Sudelseite, erstmal nur als Kapitel. Mit unfertigen Gedanken, die aber doch schon „hinaus“ möchten.
Fragmentarische Folgen aus einer Absage an meisterlichen Stilvorstand, japanische Traditionen, und überhöhte Ansprüche an Aikido, Budô, und Kampfkünste allgemein.
 Isolation, Mutation, Selektion = Evolution
Isolation, Mutation, Selektion = Evolution
Ein Dojo ohne Schulbindung, ohne Stilvorstand, ohne Vereins- und
Verbandsstrukturen ist ein bißchen isoliert. Schüler und Meister
befinden sich nicht in dem einen großen Pool von gleichgeformten,
gleichgeprüften Aikido-Übenden und -Lehrenden, der alle
(Minderheiten-) Unterschiede allmählich schleift – und
„Klon-Krieger“ produziert. In Isolation können sich
Veränderungen und Varianten (Mutationen) leichter fest- und
durchsetzen, sich im klein(er)en Kreis ausprobieren und selektieren. Das
ist ein Muster der Evolution – vermutlich auch bei Kampfkünsten.
Und fast ebenso wichtig: nicht nur bei Kampfkunst-Inhalten und
-Techniken, sondern auch bei Umgang mit und Einordnung von Kampfkunst in
heutige(r) Gesellschaft und Zeit.
Einige der hier geäußerten Ansichten und Erfahrungen sind sicher diesen Bedingungen geschuldet. Ob das „viabel“ ist, ein gangbarer Entwicklungs-Weg, wird sich zeigen.
Vorher als Link-Sammlung Budô (laut Budopedia) in der
Eigensicht und Selbstbeschreibung von Kampfkünsten. Es
handelt sich mehrheitlich um die Beschreibung der Ansprüche
(„Wegübungen, Wegkünste“) im japanischen Ideal. Wer es
mag, kann das natürlich wollen und machen. Früher fand ich das auch
nicht schlecht. Vielleicht wird deutlicher, warum (auf dieser Basis)
meine aktuellen Ansichten als Verfehlung „des Weges“, als
Irrweg, als Verharren in einer Vorstufe gesehen werden können.
 Ist das (Kampf-) Kunst? Oder kann das weg?
Ist das (Kampf-) Kunst? Oder kann das weg?
Jede Kampfkunst bedient ein bestimmtes Spektrum an Situationen (Angriffe und Abwehr), mit denen sie umgeht und dann – irgend wann mal – umgehen kann.
Sie hat andererseits blinde Flecke und „Inzest-Defekte“, die aus der (übungs-) notwendigen Beschäftigung mit sich selbst folgen.
Ueshiba Morihei („O-Sensei“) hatte einen vielfältigen Kampfkunst-Werdegang, bevor er abschließend
und über lange (Alters-) Jahre Aikido entwickelte. Davor, als angeblich unbezwingbarer Meister seiner (besten?) Zeit,
galt er auch als „harter Knochen“. Die Fähigkeit zu harten Techniken hat er natürlich auch später nicht verloren,
selbst wenn sein Aikido immer weicher wurde. Soll heißen: wenn sein weiches Aikido in einer Situation nicht funktionieren
oder angemessen sein sollte, konnte er immer noch auf andere wirksame Techniken aus seinem reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen.
Wie steht es aber mit Aikido-Schülern, die ausschließlich das „späte“ Aikido lern(t)en, von Anfang an? Die womöglich
von Meister und Schule noch gehalten sind, nicht zugleich in anderen Stilen und Künsten zu wildern, die eigene „reine Form“
nicht zu verunstalten. Oder gar, aus anderer Sicht, zu verbessern und damit letztlich den Meister in Frage zu stellen.
Kampfkunst ist keine Fertigkost (d.h. Fertigkeit), die immer gelingt, die normiert aus der Dose kommt. Sie ist ständig unfertig,
sie gilt es zu entdecken, erforschen, entwickeln, sie erfordert Neugier und Versuche (mit Übungsbereitschaft), für die – wie für vieles –
Urteilsfähigkeit und rechtes Maß geschult werden sollten. Das umfasst, im gesamten Übungsspektrum, eine individuelle Selbständigkeit, alte und (potentiell) neue Teile einer Kampfkunst abzulehnen, für sich anzupassen oder als Chance zu begreifen.
Wenn Kampf (z.B. Notwehr) neben Kunst und Technik (Jutsu) auch nur abstrakt-theoretisch noch ein Thema sein soll,
ist selbständiges Urteil für Situationen und Möglichkeiten sowieso unerlässlich. Was ist los? Was kann ich tun? Was soll ich lassen? Wie kann/soll/darf/muss ich handeln?
So gesehen ist Kampfkunst individuelle Persönlichkeits(selbst)schulung anhand einer Tätigkeit; statt einer normierten, rituell studierten Lebensphilosophie.
Man kann nicht erst eine Schülerschaft zum Budô-Kollektiv und dann – später – die Schüler zu Individuen machen. Die individuell geforderten und benötigten selbständigen Fertigkeiten sollten sofort gefördert werden.
Ein Schüler ist nicht einfach Empfänger einer Kampfkunst, sondern hat Teilhabe an ihrer Definition; denn worin sonst besteht eine Kampfkunst als in ihren Betreibern und Trägern.
Der Meister ist nur ein fortgeschrittener Begleiter, ein Anreger, ein Versucher, mit Übungen, Urteilen und Maßgaben im verhandelbaren Angebot.
Vorsicht ist geboten mit den Entwicklungslinien, die Budô stattdessen nehmen kann, weil es sie historisch und ideologisch noch enthält. Wie viele leerformelhafte Systeme läßt es sich nahezu nahtlos und einfach in beliebige Umstände einbetten und für sie nutzbar machen.
Der Rekrut bzw. sein Wille muß erst gebrochen, sein „Ich/Ego“ mit all seinen vorurteilenden Erwartungen, Gewohnheiten und Widerständen ausgelöscht, die „volle Tasse“ erst geleert werden, bevor der Ausbilder (der Meister) sie/ihn wieder füllen kann, mit dem nun „richtigen“ Wollen.
Traditionelle Hierarchie, Lehre von oben nach unten, jeder an seinem Platz und in seiner Rolle, immer Anfängergeist (Shoshin), ewiger Rekrut.
Das klingt ebenso militaristisch wie „budoistisch“, denn es entwächst derselben Haltung und Quelle – Kampf und Krieg, z.B. auch im Dienste und als Teil japanischer (Vorkriegs-) National-, Erziehungs- und Willensideologie; daran muß bei aller weichgespülter Budô-Wortwahl erinnert sein.
Einerlei, ob der Weg im demütigen(den) Drill ständiger Wiederholung besteht, oder in der Erwartung, der Schüler möge/müsse sich selbst in (s)einer Wegübung leeren, bevor er vom Meister wirklich angenommen und unterrichtet wird oder gefälligst wieder gehen soll.
Das sei nicht das wahre Budô, sondern ein verzerrtes Mißverständnis? Dann aber erst und frühestens in einem heutigen Verständnis, dessen Relevanz zudem fraglich ist.
Die Mittel, entindividualisierte Klon-Krieger zu produzieren, sind seit jeher gleich an ihrer Wurzel, wie verfeinert (und verdeckt) sie in ihren heute sichtbaren Verästelungen auch sein mögen.
Ein Schüler muß nicht „auf Null“ gesetzt werden, denn ein Dojo ist kein Boot-Camp, das ihn nach einem Reset wieder hochfährt und budô-gemäß neu verschnürsenkelt. Es ist nicht Aufgabe des Meisters, Übungen zu ersinnen, die im Schüler Demut des (Un-) Vermögens erzeugen.
Er hat keine Haltungen zu ersetzten, keine Persönlichkeiten zu formen, keine erwachsenen Menschen zu erziehen. Niemand ist durch eine Budô-Kampfkunst berufen oder befähigt, jemandes geistiger Lehrer und Erzieher zu sein.
Ein Korrektiv, auch zu und im Vorgriff auf Uke(mi) im Urteil: Aikido wird üblicherweise kooperativ und harmonisch geübt.
Harmonie ist ein Ziel, das der Abwehrende „gegen“ den Angreifer und den Angriff zu erreichen sucht (nicht „mit“ ihm).
Kooperation ist ein Mittel des Übens, um das Ziel bei potentiell nicht-kooperativen, schmerzhaften und verletzenden Techniken (in Angriff und Abwehr, deshalb ohne Wettkampf) erreichen zu können.
Es wird lange so kooperativ geübt, weil man nur so lange genug üben kann, bis es vielleicht auch ohne Kooperation geht.
Wichtig ist aber, daß Kooperation und Harmonie kein Selbstzweck sind, sondern (behauptete) Aspekte (hoffentlich) erfolgreichen Übens und wirksamer Techniken.
Ein Erfolg, eine Bestätigung der Behauptungen wird nicht wirklich geprüft, da dies vielen Absichten und Bedingungen des Aikido widerspräche – unabhängig von den Fragen, wie Tests und „Realitäten“ denn überhaupt aussehen und machbar sein sollten.
Es sollten aber Fragen erlaubt sein, ob geübte Abwehr-Techniken noch mit nicht-kooperativen, „unharmonischen“ Angriffen/Angreifern umgehen können.
Oder ob sie – vielleicht eine Verfallsform? – Harmonie und Kooperation für ein Gelingen bereits auf beiden Seiten voraussetzen.
Ich will nicht falsch verstanden werden: es geht nicht um einen betonten Kampf in der Kunst. Aber wenn fraglos nur noch „irgendwas und -wie Bewegtes“ bliebe, ginge auch Kies harken und Klo putzen als „Zen in Bewegung“.
Wenn eine Technik Probleme bereitet, dürfen die Probleme nicht nur in mangelnder Harmonie und Kooperation von Nage und Uke gesucht werden.
Die Technik selbst könnte, in einigen Details, das Problem (geworden) sein. Aufgrund eines Dekadenz-Effektes, eines Inzest-Defektes, in der Aikido- und Stil-Isolation.
Weil technische Aspekte der Führung, der Kontrolle, der Dominanz, des Angriffs nicht beachtet oder verstanden wurden.
Weil nur eine einzige variantenlose „stil-eigene“ Form geübt wird, die auch den Angriff des Uke variantenlos passend erfordert.
Klar, daß Uke eine wichtige und fordernde Rolle für erfolgreiches Üben hat. Er darf aber nicht jeder Technik zum Erfolg verhelfen,
sein Verhaltens- und Angriffsspektrum darf nicht auf reines und leichtes Gelingen verengt werden, auf Herstellung einer ganz spezialisierten Situation.
Es ist eine Gratwanderung. Wettkampf und Freikampf erzeugen ihre eigenen Probleme und sind hier (im Ansatz des Aikido) keine Lösung.
Bleiben wieder mal die ganz allgemeinen Fragen, durch welche Erfahrungen und Haltungen man situativ das rechte Maß findet und urteilsfähig wird. Irgendwo zwischen „alles“ ist Aikido, und Aikido ist (gar-) „nichts“.
Warum und wie also Aikido? Vielleicht ist es hilfreich, die Fragen zu verkleinern. Was will ich können? Was will ich erleben? Was will ich werden? Wie soll es gehen/geschehen?
 Das kann weg: ein Ost-West Problem
Das kann weg: ein Ost-West Problem
Hier sind mal nicht die Gegensätze zwischen östlichen (ost-asiatischen) und westlichen Vorstellungen gemeint. Die gibt es und sie sind auch ein Problem.
Es ist diesmal die fast automatische und innnige Verbindung, die einige öst-westliche Vorstellungen eingehen, die problematisch werden können.
Als ob Kampfkunst ohne diese sich verbindenden Kategorien nicht gedacht und probiert werden könnte.
Kampfkunst definiert und positioniert sich gegen Kampfsport. Und an die Stelle des äußeren Wettkampfes treten Ideale, innere Werte, Selbstschulung.
Es finden sich additiv, innig vereint, Konzepte von Anspruch, Lehre, und Verfassung des Betreibens von Kampfkunst. Die Notwendigkeit
der Kategorien scheint nie in Frage zu stehen, die Vereinigung auch nicht. Probleme? Alternativen?
- Ost-Anspruch: Budô/Reihô + West-Anspruch: Bildung, Erziehung, Förderung
- …
- Ost-Lehre: Meister/Schüler (Shitei) + West-Lehre: Lehrplan, Trainingsaufbau
- …
- Ost-Verfassung: Ort des Weges (Dôjô), Schule (Ryu) + West-Verfassung: Verein, Verband
- …
Budô ist nicht unpolitisch. Es ist, im Gegenteil, politisch von Geburt an.
„Politik“ sind Inhalte (“policy”), Prozesse (“politics”) und Strukturen (“polity”) der Herstellung allgemeiner Verbindlichkeiten.
Dem entspricht Budô vollkommen, in definitorischer und historischer Hinsicht. Budô ist inhaltlich ein (eher unsystematisches) System von Verhaltensnormen und Tugenden, verbunden mit Abläufen/Prozessen der (Kampfkunst-) Lehre,
eingebettet in schulische Strukturen (Organisationen) an symbolisch aufzuladenden Orten. Alles an ihm dient der Herstellung von philosophisch und symbolisch aufgeladenen Verbindlichkeiten, im Rahmen einer Kampfkunst
oder, als Lebensphilosophie, allgemein im ganzen übrigen Leben, aus welchen Motiven auch immer.
Auf die Motive, deren Umsetzung, und die praktischen Folgen, gewollt oder ungewollt, käme es aber an.
Wer Budô auf den Lehrplan setzt (oder dies ablehnt) macht damit Politik, handelt politisch. Es hilft nicht, Budô nur in der Eigensicht und Selbstbeschreibung von Kampfkünsten zu sehen.
Das hebt Geburtsfehler (Entstehungszusammenhänge) und andere Verwendungen (z.B. auf Basis der Leerformeln) nicht auf und scheidet nicht aus, was im Budô potentiell steckt.
Selbst bei bestem selektivem Willen kann alles wieder zum Vorschein kommen und entgegen den besten Absichten verwendet werden.
 Aiki-Smerch
Aiki-Smerch
—  — —
 Freizeit-Aikido
Freizeit-Aikido
Der Begriff „Freizeit-Aikido“, so wie er mir zuerst begegnete, war von
einem japanischen Meister und Stilvorstand als Kritik und Vorwurf an seine „Besten und Treuesten“ gemeint, als Abgrenzung
zu dem erwünschten dauer- und gewissenhaften Üben eines „starken“ Aikido.
Das natürlich nur ganzheitlich gelingen könne, mit allen mentalen und rituellen Anstrengungen
inbegriffen, dem Budo eben.
Ich habe Freizeit-Aikido, meinetwegen mißverstehend, lieber als Tatsachenbeschreibung aufgefasst,
als zu akzeptierende Diagnose des gegenwärtigen Übens und Praktizierens.
Wie und was soll man üben, wenn man „nur“ Freizeit-Aikido macht?
Welchen Grad an Könnerschaft oder gar Perfektion soll man vernünftigerweise anstreben,
kann man erreichen? Was ist mit „weniger“ möglich, wenn doch so gerne
weniger auch mal mehr sein soll? Kann Aikido mit geringeren Ansprüchen funktionieren?
Fragen über Fragen.
Das stetige Wiederholen einer (oder weniger) Technik(en) – immer gerne Shiho-nage – kann nervtötend sein.
Diesen „mentalen Angriff“ zu überwinden, ist dann Teil der Übung. Meister sagen
mit Vorliebe, daß in dieser einen Technik/Übung das „ganze“ Aikido liege, gefolgt
von Anekdoten des eigenen Lernverlaufes und der Praxis in japanischen Dojo. Und noch ein Meisterspruch:
das Wesen der Übung ist die Wiederholung! Könnte glatt von mir sein.
Aber wenn in einer Technik die Muster und Prinzipien für alle Techniken im Aikido stecken, warum dann nicht
in allen anderen auch? Dann steckt in allen Techniken, wenigstens teilweise, das gleiche Muster. Man könnte also mit der gleichen Logik viele verschiedene Techniken und Varianten
üben, und mit jeder, auch bei noch so frühem Übungsabbruch, die Muster für alle anderen mitlernen.
Es wird schon etwas hängenbleiben und die Zusammenhänge zwischen allen Techniken erschließen sich früher oder später,
parallel zum Können.
Im Nebeneffekt sickern gleich eine Reihe von Varianten in das motorische Gedächtnis, zusammen
mit der Mustererkennung, wann sie beim Uke (in welcher Position und Situation) passend sind. Da man
im großen Ablauf einer Technik häufig mehrere Positionen und Situationen durchläuft, hat man auch
gleich alternative Varianten für den Fall, daß man in einer stockenden Technik „umschwenken“
muß.
Nervtötend können beide Wege sein, vielleicht sogar alle. Beim einen die ewig andere Korrektur der immer
gleichen, sich gleich anfühlenden Technik, die man anscheinend nie „können“ wird. Beim anderen
der Wechsel zu anderen Techniken, bevor man das Gefühl hat, irgendwas dabei (neu) gelernt zu haben.
Beim einen das statische Detail, beim anderen das dynamische Ganze, das nie zufrieden stellt, zum befriedigenden
Ende führt.
Man kann endlos z.B. Shiho-nage üben. Im nächsten Lehrgang, im nächsten Dojo, beim nächsten Meister
oder Uke, am nächsten Tag, wird man angewiesen (oder erleben),
es wieder anders machen zu müssen. Erfahrungsgemäß wird es eine „perfekte“ Technik nicht geben, die man sich im
Schmuckkästchen ins Regal stellen kann, die man abschließend „hat“. Erst recht nicht bei freizeitlichem
Übungsstil, was Dauer und Intensität angeht. Perfektion ist diktatorisch: es kann nur schlecht(er) anders sein.
Aber „anders“ wird gebraucht.
Mein Fazit: alle Wege führen schließlich zum Ziel; ich kann das zumindest nicht ausschließen.
Ich bevorzuge einen bewegungs- und variantenreichen Weg, weil (1) „in Bewegung kommen“, Ausweichen und
Drehen, seine „relative Position“ verbessern, Schreckstarre und Lösungssuche überwinden, wichtiger sind als eine perfekt gelingende Technik;
und (2) das Ikea-Prinzip („Erkenne die Möglichkeiten“) erfordert, über viele Varianten
zu verfügen. Nur dann kann man eine zur Situation vielleicht passende wählen, die hoffentlich nicht so
ganz perfekt sein muß um doch noch zu funktionieren. Sobald Nage in Bewegung (gekommen) ist, muß er
darauf vertrauen, daß die richtige Technik „von selbst“ an ihren Platz fällt, daß „der
Körper“ sie im motorischen Gedächtnis findet, weil sie das folgerichtige Muster zur geübten Bewegung
und Nage-Uke-Position ist.
Ich bevorzuge auch ein „undifferenziertes“ Training. Gezeigt wird die Technik, wie sie
mal aussehen soll. Dazu Hinweise zur Vereinfachung und zu besonders beachtenswerten Stellen.
Der fortgeschrittene Übende (Sempai) moderieren es zu einer mit seinem Partner (Kohai)
gemeinsamen Könnens-Stufe.
Es hilft aus meiner Sicht nicht, die Aikido-Muster und -Prinzipien perfekt an wenigen Techniken
verinnerlicht zu haben. Technik-Varianten, die nicht auch automatisiert im motorischen Gedächtnis sind,
sind schlicht nicht da, wenn man sie braucht. Deshalb lieber über mehr unperfekte Varianten
verfügen, die dann schon „irgendwie“ passen, passend gemacht werden.
– Aber das sind persönliche Vorlieben.
 Rituale und Symbole
Rituale und Symbole
Vor Symbolen salutieren? Rituell? Nicht reden, nicht lachen? Nicht vom Gezeigten abweichen? Rollen erfüllen (Sensei, Sempai, Kohai)? Nicht fragen, in Frage stellen? Immer Rei, immer Respekt, immer Haltung, immer Übung? Immer dem Shomen, dem Sensei zugewandt?
Wer Budô zur – meist enger werdenden – Verhaltens-Norm macht, zum Trainings-Mittel und -Ziel, erschafft damit i.d.R. auch die dann Un-Normierten,
die sich plötzlich als Abweichler und Unangepasste wiederfinden – und die Frage, wie mit ihnen umzugehen sei. Worüber meist wenig nachgedacht (oder konsequent gedacht) wird,
ist die Funktion des Abweichlertums, des „Anderen“, des nach Budô-Maßstäben nicht Funktionierenden. Sie zeigen nämlich,
daß es auch anders geht, daß davon höchstens eine (vorgestellt) heile Budô-Welt Risse bekommt, aber mehr auch nicht. Sie
schärfen das Urteilsvermögen in den Fragen, was wirklich wichtig und unverzichtbar ist, warum ich selbst ein
bestimmtes Verhalten zeige bzw. (trotzdem) behalte. Besonders bei letzter Frage sind die schlechten Antworten interessant.
Warum also praktiziere ich Budô in konkretem Verhalten (Etikette, Rituale, Tugenden) und vielleicht noch in Verhaltens-Erwartungen? Die weniger anspruchsvollen,
überdenkenswerten Antworten wären:
- Weil alle es (so) machen.
- Weil der Meister es gesagt/gewünscht hat.
- Weil ich (dann) besser bin als andere, meinen Status hebe, anerkannt werde.
- Weil die klaren Rollen-Erwartungen entlastend sind (bzw. jap. gesichtswahrend).
Wir möchten alle gern dazugehören, aber bitte doch im oberen Drittel der anerkannt Vorbildlichen, mit Status-Bestands-Sicherheit, ohne Irritationen.
Budô ist (und bedient) ein Modell japanischer Vorlieben für klare Rollen, in denen man sich sicher bewegen kann, in denen vorgegebene Etikette
und klare Hierarchien/Positionen das soziale Schmiermittel sind, wo nichts ständig neu erkannt und ausgehandelt werden muß, wo man nicht in Frage gestellt wird sobald man „drin“ ist.
Mögliche Fehlentwicklungen rituell geforderter/gefestigter Verhaltensweisen
- sich ausnutzen lassen
- andere missionieren (oder ausgrenzen)
- sich selbst lizensieren, cf. “Licensing-Effect”
Wie gehe ich (in Eigeneinschätzung als „Disziplinierter“, ob Fremd- u/o Selbst-) mit den weniger Disziplinierten um? Wie werte ich deren Verhalten? Wie reagiere ich darauf?
Welcher konkrete Schaden oder Nutzen entstünde durch Duldung oder Disziplinierung? Was soll und zu was führt die symbolische Aufladung von – allg. profanen – Sachen
(Dojo, Shomen/Kamiza, Jo, Bokken, Katana, Tanto etc. = Orte, Räume, Schriftzüge, Abbildungen, Einrichtungen, „Waffen“)? Vergleichbar
mit hoheitlichen oder religiösen Entitäten? Sind das Grüßen oder Respektbezeugen gegenüber Sachen (Dingen, Räumen) wünschenswerte Verhaltensmuster,
oder entwertet es z.B. gleichartige Gesten gegenüber Personen?
Leider wird oft erst (und oft nur) ein kampfkunstpezifisches Deutungsangebot zu Ritualen und Symbolen gemacht,
obwohl vieles davon eben zwei- bis mehrdeutig (ambigue), zumindest uneindeutig oder sogar doppelwertig/zwiespältig (ambivalent) wäre.
Es wird dagegen wenig bis nicht nach den tatsächlich beobachtbaren Handlungen und Dingen gefragt,
die man auch neutral in Abläufen und Wirkungen beschreiben könnte. Beispielsweise als
• Übergangsrituale (Passagenrituale)
• Gemeinschaftsrituale
• Rituale zur Verstetigung von Institutionen und Strukturen (Tradition, Hierarchie, „Macht“)
Es gehen stattdessen Bedeutungen vor Wirkungen, Interpretationen vor Funktionen.
Es sollte möglich sein, ein so weites Maß für Formen und Teilnahme zu finden, das Abweichungen zulässt, weil
dadurch das eigene Tun (gefühlt) nicht in Frage gestellt, sondern individuell gut begründet wird. Ich mache etwas (z.B. Matten putzen) also nicht aus den
oben genannten Gründen, sondern weil es für mich richtig ist (z.B. saubere Matten haben). Ich erweise Höflichkeit und Respekt nicht, weil ich es erwarte,
sondern weil ich es geben will und für angemessen halte. Das eigene (vielleicht vorbildliche) Verhalten ist keine stumme
Aufforderung, es gleich zu tun, d.h. eine Erwartung und (Ab-) Wertung.
Es mag, aus spieltheoretischer Sicht, altruistisch gemeinte Erziehung und Strafe geben. Es gibt aber auch Geschichten vom Schlechten des Guten,
z.B. weil man meint, nicht gut und glücklich sein zu können, solange nicht alle gut und glücklich sind. Die Tribunale der Tugenden – „Du bist nicht, wie wir Dich haben wollen!“ – deren (bloße) Sichtbarkeit gefordert und gewertet wird.
Dabei könnte man den Abweichlern auch gute Gründe oder guten Willen unterstellen, und eine Chance zu gemeinsamer oder wenigstens eigener Steigerung sehen.
Wenn letzteres klappte, wäre es sogar ein Grund für Dankbarkeit und Respekt gegenüber dem Mut zur Abweichung.
Also: gebt der Abweichung und Individualität soviel gesichts- und respektwahrenden Spielraum, wie Ihr ertragen könnt und nutzen wollt! Das ist eine Übung des rechten Maßes.
Das Klatschen (mit) einer Hand? Ganz einfach: eine Klatsche! Koan gelöst.
Besondere Etikette in Kampfkünsten – als wüßten die meisten Aikidoka nicht bereits, was üblich gutes Benehmen sei.
Machen Budô-Etikette besseres Aikido? Leider verlässt die Begründung von Budô meist nicht die sektenhafte Geschlossenheit der Kampfkünste.
Kämpfen ist heute ein Tabu, und wäre i.d.R. gesellschaftlich geächtet, wenn es nicht in kontrollierende Rituale und Regeln
eingebettet ist. Das gilt für sportive Wettkämpfe und noch mehr für Kampfkünste ohne Kämpfe.
Regeln (der Etikette) zu brechen oder zu mißachten, die man nicht beherrscht, kann wohlfeil sein. Es hängt
natürlich von den Regeln und den Umständen ab, und „in der Regel“ gilt es für „Regeln des guten Handwerks“.
Das ist schon eher der entscheidende Punkt: verbessern die Regeln das Aikido-Handwerk, die Ausführung von und das Verfügen über Techniken, den Rahmen der Aneignung und Übung?
Oder stecken sie nur kleine Königreiche (private „Meisterreiche“) ab und definieren die Hofetikette, machen kleine Meister darin groß?
 Die Frage der Etikette
Die Frage der Etikette
Die Frage der (Budo-) Etikette (TEXT/PLAIN-Format)
Teile meiner Antwort sind – verändert – dieser Seite entnommen oder eingefügt.
Der verlinkte Text ist Ergebnis der „Frage der Etikette“, die im Dojo (des SVL)
erstmals am 14. Januar 2017 vom Trainer den Trainings-Teilnehmern gestellt wurde.
In der Pause wurde um Ansichten und Meinungen dazu gebeten, um ein
Stimmungsbild für die Trainerrunde, für spätere/weitere Entscheidungen.
Ich hatte die Frage in der Kürze der Zeit nach meiner Einschätzung nur
unzureichend beantwortet, weil nur allgemein und wenig konkret (was gut
sei, was nicht). Da mich eine genauere Antwort für mich selbst
interessiert, hatte ich sie später am Tag verschriftlich und (als
Nebeneffekt) dem Fragesteller geschickt. Diese erste Antwort-Version
sind die linksbündigen Absätze. Im Laufe der Zeit habe ich den Text
dann sporadisch immer weiter ergänzt (eingerückte Absätze), zur eigenen
Meinungsbildung, um Argumentationen oder Gedankengänge zu entwickeln.
– stus
 Aikido- und Dojo-Modi
Aikido- und Dojo-Modi
Soll Aikido bzw. eine Kampfkunst des Typs der „Wegübung“ allgemein, ein besonderer Zustand sein? Während der Übung?
Soll ein Dojo ein besonderer, symbolisch aufgeladener Ort/Raum der „Wegübung“ sein?
Sollen die Etikette und Rituale, die dort einführend/einstimmend und während des Trainings praktiziert werden, einen besonderen Zustand hervorrufen, der den „Wegübungen“ förderlich oder gar vorausgesetzt ist, vielleicht sogar „Wegübung“ in sich selbst ist?
Und soll sich alles, als mentale Modi, gewollt vom Alltag absetzen, sich unterscheiden?
...
Eine andere Metapher, ein anderes Modell: Aikido-Kampfkunst als (Er-) Forschung und „Wissenschaft“ besonderer Bewegungen, Haltungen, Handlungen. Jede Technik ist eine Hypothese, eine Methode, ein Experiment. Jede Nage/Uke-Situation ein Versuchsaufbau.
Jedes Dojo ein Labor. Oder salon « littéraire » d’arts martiaux, im Sinne der Aufklärung? Man kann, vielleicht sollte, es forschend und aufklärend angehen. Kritik ist dann keine Frechheit gegenüber einem Meister,
sondern nur Ergebnis der notwendigen Skepsis. Notwendig, weil Ersatz des Kompetitiven in seiner korrigierenden Funktion; und somit Bedingung des Fortschritts, des Fortschreitens, des Lernens.
 Uke(mi) im Urteil
Uke(mi) im Urteil
Es gibt wenigstens zwei potentiell schwierige Uke-Typen: die Anfänger, die zuwenig wissen, und die (Halb-) Fortgeschrittenen, die zuviel, aber nicht genug wissen.
Anfänger agieren und reagieren eher unvorhersehbar, achten wenig auf sich selbst und das, was mit ihnen passiert (d.h. was Nage
mit ihnen macht). Ihnen für eine wirksame Technik Gleichgewicht und Kontrolle vollständig zu nehmen, ist ohne fähiges Ukemi heikel.
Als wahrnehmbare Wirkung bleibt nur der (Führungs- oder Fixier-) Schmerz angewandter Hebel oder Druckpunkte.
Fortgeschrittene behalten gerade wegen eines fähigen Ukemi während einer Technik einen guten Teil ihres
Gleichgewichts und ihrer Kontrolle. Eben weil sie es bis zu einem (selbst-) bestimmten Punkt zur Fortsetzung von Achtsamkeit und Angriff und zur
kontrollierten Einleitung der Fallschule brauchen, bzw. in der Uke-Rolle genau dafür geschult werden.
Aber wofür nutzen sie ihr frühes Können (über Kontrolle) und Wissen (über Technik)?
Die Rolle des Uke … [PDF, ca 280 KB, lokale Kopie, *] S. 17
Der Uke [trägt] eine große Verantwortung. Jede Technik dient dem Studium
einer bestimmten Richtung und Anwendung der Kräfte. Der Uke muss dies verstehen und die
Fähigkeit besitzen, einen aufrichtigen, starken, fokussierten und der abgefragten Technik
angemessenen Angriff zu geben.
Ein schwacher Angriff ist unakzeptabel. Ein täuschender Angriff ist unakzeptabel. Da der Uke
weiß, welche Technik gezeigt werden soll, kann er immer deren Ausführung verhindern. [...]
Es ist nicht Ukes Aufgabe, Werturteile
abzugeben. Du nimmst nicht Ukemi um Deinen Partner schlecht aussehen zu lassen. Du
nimmst nicht Ukemi um Deinen Partner gut aussehen zu lassen. Springe nicht in einen
spektakulären Fall wenn der entsprechende Kraftfluss nicht vorhanden ist. Gebe kein Urteil ab
indem Du gelangweilt oder widerstrebend fällst – so als ob Dein Partner Dich nicht wirklich
geworfen hat. Beides ist unaufrichtig. Denke daran – Du nimmst Ukemi zum Schutz vor
Verletzungen, und nicht zum Demonstrieren von Überlegenheit. Kurz: Uke verhält sich der
Situation angemessen.
[*] Olaf T. Schubert, Trainingshandbuch 06/2003, Shoshin Aikido Dojo Rodgau c/o “Aikido Schools of Ueshiba” (ASU), Mitsugi Saotome
Nochmal Ukemi, von anderer Seite „aufgerollt“: Wie und zu welchen Zwecken mache ich Ukemi?
Ich schütze mich durch Ukemi vor Verletzungen und ermögliche meinem Partner rückhaltloses Ausführen und
Üben der Techniken.
Da „Automatisierung“ des richtigen Flusses eine wichtige Komponente der Wirkung von Techniken ist,
blockiere ich nicht. Das erst macht andauernde und vollständige (!) Wiederholung möglich. Erst wenn der Gesamtablauf sitzt, ist der Kopf genügend
frei, um die Aufmerksamkeit auf die Details im Ablauf zu lenken, sie zu optimieren, ohne ständig aus der Technik zu fallen und
den Fluß zu verlieren. Das ist „Dienst am Partner“, am Üben-Können, und ist eher selbstlos gedacht.
Ebenso, wenn Uke entgegen seiner „empfangenden“ Rolle einen Anfänger in und durch den Wurf führt, der ihn endlich selbst wirft.
Er gibt Anreize für die richtige, geforderte Richtung und blockiert (nur und nebenbei) alle anderen für diese Technik „falschen“ Richtungen.
Anspruchsvoll für Uke ist, daß er beide Rollen zugleich denken und führen muß.
Ukemi ist n.m.M. allerdings noch viel mehr: eine Aikido-Übung zum Nutzen des Uke,
eine Körperschulung für seinen Nage-Part; ganz eigennützig gedacht. Ob ich einen Angriff weiterführend aufnehme, d.h. ohne zu blockieren, und
in eine Wurf-, Hebel- oder Haltetechnik umleite – oder ob ich eine Abwehr meines Angriffs ohne zu blockieren aufnehme und
in eine mich schützende Roll- oder Falltechnik umleite – ist letztlich einerlei und „im Prinzip“ gleich.
Beide Male spüre ich die Führung und Richtung, die ich vom Partner bekomme, und lerne sie zu nutzen. Dazu muß ich sie aber erstmal zulassen (können).
Natürlich kann ich meine Chancen als Angreifer wahren, indem ich die Abwehr blockiere und zunichte mache. Das ist aber nicht der
Ansatz des Aikido. Stattdessen wahre ich meine Chancen (z.B. auf Konter, auf Lücken im Fluß, in der Deckung, in der Wendung und Ausrichtung, in der Aufmerksamkeit und Kontrolle), indem ich keinen Widerstand zeige,
sondern mitgehe und mitnehme. Das „Lesen“ des Partner und seiner Bewegungen ist in jeder Rolle entscheidend, und kann in jeder Rolle
zu brauch- und anwendbarer Reaktion, zu gedankenloser Gewohnheit trainiert werden.
Also mindestens gleichberechtigt in der Uke-Rolle, wenn nicht sogar mehr, intensiver und flexibler, bei freiem Nage.
Und schließlich ist Ukemi, im Verbund mit Nage/Tori, in wichtiges Mittel um Flow zu erreichen und im Flow zu bleiben.
Ich kann Ukemi so fließend ausführen, daß die Verbindung zum Partner während und zwischen den einzelnen Würfen nicht abreißt, der Blick- und Körperkontakt
(die Annäherung, meine Präsenz als Angreifer, die Gegenwart aller Möglichkeiten) konstant erhalten oder erneuert wird. Selbst bloßes Aufstehen und wieder (Blick-)
Zuwenden, Haltung einnehmen und Bereitschaft „senden“ zum Nage, in Fortsetzung des Rollens oder Fallens oder aus Fixierung, angepasst der
Fließ-Geschwindigkeit der ganzen Folge, gehören dazu. Nage kann dann unmittelbar schon darauf (re-) agieren, ohne einen abgegrenzten, vom Fluß isolierten Angriff
abwarten zu müssen. So entsteht, zusammen mit weiteren Bedingungen, Flow.
Am Rande gibt es vielleicht noch ein spezielles Ukemi des mit dem Meister/Trainer vorführenden Uke: er sollte
die Wirkungen und Absichten der zu zeigenden Techniken möglichst sichtbar machen. Ebenso sichtbar wie alle anderen bereits genannten Aspekte des „vorbildlichen“ Uke(mi). Und dies gegebenenfalls unter den erschwerten Bedingungen
des Zeigens und Redens, der geteilten Aufmerksamkeit des Trainers.
Auf eine Formel gebracht: Nage/Tori lernen (zuerst) einen technischen Aspekt des Aikido,
Uke lernen (sofort) die „Innere Führung“, das richtige Erkennen von und Reagieren auf Führung.
Das Ziel ist Leichtgängigkeit mit elastischer Spannung, auf beiden Seiten, in beiden Rollen. So wie die Führung von Nage „leicht“ in kontrolliertes und weiches Ukemi
geleitet werden soll, so soll der Griff des Uke durch Nage „leicht“ in eine Wurf- oder Hebeltechnik geführt werden.
Wie kann ich das, was auf mich einwirkt, in meinem Sinne wirken lassen, es je nach Rolle und Phase „umwidmen“ in einen Fall oder einen Wurf?
Uke gibt erst (Angriffs-) Energie/Führung, erhält dann (Wurf-, Fall-) Energie/Führung. Nage
erhält erst, und muß Art und Richtung erkennen, und gibt dann; je nach, und in dann veränderter, Art und Richtung.
Ziel ist, daß es „leicht“ geht, und „leicht“ geht es mit richtig gerichteter
Energie. Die Richtung erspüren wir durch Elastizität, die Führung geben wir durch Körperspannung. Deshalb „elastische Spannung“.
Was ist ein sinnvoller Angriff? Beziehungsweise, was bedeutet diese Forderung an einen Uke?
Es bedeutet nicht, daß ein Angriff „als Angriff“ sinnvoll sein soll. d.h. mit Aussicht auf Erfolg.
Jede Kampfkunst ist ein eigenes, teils geschlossenes Biotop (d.h. eine Auswahl) von Angriffen und Abwehr, die aufeinander
abgestimmt sind und innerhalb der Kunst sinnvoll sind, bestimmte Aspekte üben, und zusammen kontrolliert übbar sind.
Im Aikido ist ein „sinnvoller Angriff“ eine Aufmerksamkeits-Übung des Uke. Er soll
die Haltung des Nage in den kleinen Details erkennen (die „Signale“, die Nage gibt) und den dazu passenden Angriff wählen und gewissenhaft (impulsgebend) ausführen.
Er soll dem Nage keine Unmöglichkeiten – bzw. nicht zu viele – durchgehen lassen, z.B. unmotiviertes Folgen ohne Führung oder Schutz, wo sich beim Nage Öffnungen für offensichtlich leichtere Angriffe angeboten haben.
Immer angemessen der Übungs-Situation und -Absichten, der Geschwindigkeiten, der Fähigkeiten. Immer mit der zielführenden Frage, ob damit noch etwas gelernt oder doch die ganze Übung (statt nur eines bedenklichen Details) unterbunden wird.
Ist der Angreifer aufmerksam genug, dies zu leisten? Damit übt er
letztlich Aikido: für die Rolle des Nage, der für einen erfolgreichen Wurf (eine Abwehr) den Angriff/Angreifer ebenso lesen können muß.
Ebenso kann es eine Übung des Nage sein, gemäß der Frage, ob er mit seiner Haltung (Kamai, Hanmi)
klar lesbare Signale gibt. Oder ob die Ausstrahlung indifferent ist und er nur einen ebensolchen, sich erst spät entscheidenden und klärenden Angriff
erwarten kann.
Uke-Sein ist eine Übung in Aikido. Nicht eine Übung in verdrucksten, halbgaren, lauernden, oder fintenreichen, unwerfbaren, erfolgsbesessenen Angriffen.
Nicht mit „entkoppelten“ Körperteilen, die die Wurf-Wirkungen wohlwissend begrenzen. Nicht mit „vorauseilenden“ Bewegungen,
die entweder (sich abwendend) den Angriff aufgeben, den Impuls abbrechen, oder schneller als Nage eine vorteilhaft stabile Position zu erreichen suchen.
 Randori und „Flow“-Konzept
Randori und „Flow“-Konzept
Warum mache ich / macht man Aikido? Eine Antwort führt zum
„wie“ des Machens, einschließlich des Lehrens. Antriebe
sind Neugier und innere Belohnung, an Bewegungsforschung und
Bewegungsübung, an einem Tun mit ästhetischer Verführung in guter
Gesellschaft. Die Bewegungsforschung richtet sich auf einen Ausschnitt
an Kampfkunst-Techniken: worauf muß ich bei ihnen achten, damit sie
wirksam sind bzw. überhaupt sein können? Die Bewegungsübung richtet
sich auf die angemessene Auswahl und wirkungsvolle Ausführung in
Kampfkunst-Situationen. Effektives „Etwas“ (z.B. der
Hammer): eine Wirkung soll erreicht werden mit etwas, das in einem
bestimmten Sinne wirksam ist. Effizientes „Tun“ (z.B. der
Schlag): es soll so wirkungsvoll ausgeführt werden, daß der
gewünschte Effekt auch eintritt (z.B. der Nagel steckt und hält). In
der Summe (der Tätigkeiten, der Bewegungsstudien unter bestimmten
Bedingungen) führt dieses Kampfkunst-Machen zu intensiven
Sinn(es)erlebnissen (Stichworte Peak und Flow) und
innerer Belohnung (Stichwort intrinsische Motivation).
Das Flow-Konzept von Mihály Csíkszentmihályi: (m)eine  Abschrift Abschrift der Kernthesen und Merkmale.
Es ist nicht möglich, ein ganzes Training hindurch im engeren Sinne im
Flow zu sein. Aber das Training arbeitet daran, die Bedingungen
herzustellen, so daß in einigen Übungen, z.B. Randori, im
Training Flow erreicht und erlebt werden kann. Die innere
Belohnung ergibt sich, wenn man etwas im Flow machen kann, aus
dem befriedigenden Erleben des Flow-Zustandes. Dabei sollten
die Verhaltens- und Stimulusrahmen aber nicht durch rituelle
Exklusivität und Strenge („Dojo-Modus“) bestimmt und
erzwungen werden, eben damit diese Rahmen nicht zur zwingenden und
andernorts nicht einlösbaren Bedingung werden. Achtsamkeit und
Kampfkunst-Flow sollten einer Alltagshaltung (u/o ohne Ki-no-neru)
entspringen können, auch unter ungünstigen oder gelösten
Bedingungen, weil letztlich in der Kampfkunst-Situation die Person
selbständig in den Flow eintreten können sollte und im
Flow ihre Handlungen und Umwelt kontrolliert.
Ein Randori („Freikampf“, zumindest freies Greifen
und Werfen mehrerer Angreifer) sollte einen Lerneffekt bzw. ein Lernziel
haben, z.B. Flow. Sonst entwickelt es sich zu schnell zu nur kurzer
Freiheit und zu langer Enttäuschung. Der Lerneffekt muß sich von
Übung zu Übung weiter entwickeln können. Die Dauer des Randori und
das Verhalten der Teilnehmer müssen dazu beitragen, Flow zu
erzeugen und erhalten. Für Flow gibt es Bedingungen, die es fördern,
die einen weichen Regel- und Technik-Rahmen bilden können. Die flow-förderliche Richtung muß stimmen.
Meist reicht es, die Faktoren zu reduzieren, die Flow üblicherweise abbrechen lassen (zu häufige Über- oder Unterforderung, zu viele Stimuli, Kontrollverluste).
Auch ein Nage, der den Uke keinen Flow ermöglicht („gönnt“), z.B. durch zu anspruchsvolle, überfordernde und riskante, „furchterregende“ Würfe, wird dies in den Angriffen, in Flow-Verlusten gespiegelt bekommen.
Die Uke dienen diesem Ziel: dem Lernen des Nage, dem Ki-no-nagare,
und nicht etwa der Jagd auf den Nage.
Das Flow-Erleben ist die innere (intrinsische) Belohnung, die Motivation für weiteres Üben.
Man erlebt Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit („Könnerschaft“),
entstehend aus technischer Verfügungssicherheit und Wirkungssicherheit.
Slow-Flow-Randori, 5+ Minuten, ist das Mittel und Ziel.
Nicht die Angreifer dominieren, sondern nur sich nicht dominieren lassen.
Genügend Ruhe und technisches Einfach-Repertoire für 4 1/2 Minuten, dann
noch 2 bis 3 originelle Zaubereien, i~wo eingestreut in die Summe der übrigen
30 Sekunden.
Zwei „taktische“ Verhaltens-Forderungen (oder Vorgaben) für
ein Randori verschlechtern es meine Erachtens: (#1) Bringe den aktuellen
Angreifer im Abschluß einer Technik zwischen Dich und einen nächsten
Angreifer, um diesen zu behindern. (#2) Trete einem Angreifer
frühzeitig entgegen (direkter Eingang „in ihn hinein“,
Irimi-Prinzip) und störe seinen Angriff, damit er sich nicht wirksam
entfalten kann.
Abgesehen davon, daß eine Taktik die andere behindert … ich habe
z.B. weniger Bewegungsfreiheit (mich zum nächsten Angreifer zu
positionieren) mit einem wie auch immer fixierten (noch gefährlichen?)
Angreifer nahe bei mir.
#1 führt oft dazu, daß Nage seine Technik über den richtigen
Wurf-Zeitpunkt hinaus verlängert, um den Uke zur Deckung zu behalten,
zu führen/werfen. Die Technik verschlechtert sich: wird
unabgeschlossen, unharmonisch, stockend statt fließend, der gesamte
Bewegungsfluß des Nage zwischen den Angriffen wird unterbrochen. Der
Uke ist noch gefährlich nahe, bei fraglicher Kontrolle, und wird
anschließend einfach weggestoßen, mit fraglichem Ukemi.
#2 führt oft dazu, daß Nage kein klares Griff-Ziel mehr bietet, daß
ein Uke keinen Standard-Angriff mehr machen kann, sondern nur noch eine
Art unberechenbaren Not-Angriff, der Nage letztlich zu einer
unkonventionell improvisierten Not-Technik zwingt. Möglicherweise
unwillentlich beschleunigt Nage damit das gesamte Randori, wenn die Uke
notgedrungen doch noch zu einer Angriffsaktion kommen wollen.
#1 ist als Taktik nicht erweiterbar. Bei mehreren Angreifern
funktioniert sie nicht, sondern behindert durch die künstlich
verlängerte Nähe zum aktuellen Angreifer, der Bewegungsfluß und
-freiheit einschränkt. Nage sollte so über Techniken verfügen, daß
jede fortgeführte Abschlußbewegung eines Wurfes in eine neue
Zielvorgabe und eine weitere neue Technik (entsprechend eines nächsten
Angriffs) münden kann. Das Ziel ist nicht, kein (oder ein
unbestimmtes oder nur teil-gedecktes) Ziel zu bieten, sondern ein
klares (selbstbestimmtes, den Angriff bestimmendes) Ziel
vorzugeben.
#2 ist eine Sache von „Vorhand“ (Sente) und
„Nachhand“ (Gote), bzw. von (Angriffs-)
Intention/Initiative. Der Nage sollte mit dem „Nachteil der
Nachhand“ umgehen, der Uke eine klare Initiative haben können.
Die Rollenverteilung sollte eindeutig sein. Das Können des Nage besteht
in seiner Fähigkeit, „zu spät“ erfolgreich zu reagieren,
und dabei „nur“ zu neutralisieren. Die Kunst ist,
nachträglich dafür die Muster und Vorgaben der Angreifer/Angriffe zu
spüren (d.h. auf sich wirken zu lassen) und zu verwandeln.
Die Nachhand-Taktik besteht darin, ein klares Angriffsziel zu bieten, um
den Angreifer zur Wahl einer klaren (d.h. vom Nage vorhersehbaren und
beherrschbaren) Angriffsart zu leiten oder zu nötigen. Es ist dagegen
nicht nötig, die Angreifer zu dominieren. Es ist ausreichend, daß der
angegriffene Aikidoka sich nicht dominieren oder irritieren lässt, daß
die Angriffe (die „Aggressionen“) nutz- und wirkungslos
gemacht werden; laut Aikido-Konzept. Es ist vorteilhaft, rechtzeitig zu
sein vor und bei Griffen, aber nicht nachteilig und hinderlich, spät zu
sein. Denn bei mehreren Angreifern ist man früher oder später immer
mal „zu spät“. Souverän ist, wer fehlertolerant den
Nachteil in Vorteil verwandelt, wer sich durch Fehler nicht beeindrucken
und aus der Ruhe, aus der Wahrnehmung der Angreifer/Angriffs-Muster
bringen lässt, wer noch ruhig reaktionsfähig und reaktionssicher
bleibt.
Natürlich ist das keine zwingende Kampftaktik-Entscheidung. Aber eine
Entscheidung, die bereits in der Wahl der Kampfkunst (d.h. des
Aikido) und damit in der Wahl der Mittel prinzipiell angelegt ist.
Eine frühere (Nov.2019) Problembeschreibung, ein Vorläufertext:
DAS PROBLEM:
Ständiger Rückzug im Randori, in rückwärtiger Bewegung. Ständig „auf der Flucht“.
Es entsteht, weil man sich durch die Angriffe bedrängt und unter Druck
gesetzt fühlt. Es hängt mit der Furcht zusammen, für seine Techniken
„zu spät“ zu kommen, sie nicht entfalten und den Angreifer
nicht kontrollieren zu können.
Besonders dann, wenn man in seinem Repertoire auf lange, dynamische, und
Platz (viele Drehungen) brauchende Techniken angewiesen ist. Das sind
die typischen Trainings-Techniken, mit denen man die grundsätzlichen
Aikido-Bewegungsmuster einübt. Aber die Angriffsaufnahme muß i.d.R. zu
gut sein, der Angreifer zu lange kontrolliert werden, und er ist dabei
zu lange in gefährlicher Nähe, bis er dann endlich (d.h. vielleicht)
geworfen wird. Und was macht man, wenn etwas „nicht geht“?
Im Randori sind diese Techniken, so schön sie oft sind, nur bedingt
brauchbar. Wenn sie nicht klappen, steckt man meist fest. Deshalb, für
Zeit und Platz und Abstand, um Ausgangshaltung zu gewinnen und
Entscheidungsnot zu meiden, die Rückwärtsbewegungen. Denn die
typischen Trainings-Techniken decken nicht die typischen
Randori-Situationen ab.
KEINE LÖSUNG:
Eine stattdessen gängige, aber unangenehme Lösung (bzw. Entwicklung)
im Randori ist dann, gezielt und forciert die Initiative zu übernehmen
und in die Angriffe (und Angreifer) sehr frühzeitig
„hineinzugehen“. Das ist zwar eine (teilweise)
gute Strategie, aber sie hat auch schlechte Nebenwirkungen. 1: Sie
beschleunigt das Randori, macht alles hektischer, weil alle (auch die
Uke) immer schneller werden. Und irgendwann ist es dann doch wieder
zu schnell für den Nage. 2: Die Angriffe entfalten sich
garnicht mehr, weil die (im Angriff gestörten) Uke fast sofort (zum
Selbstschutz) ins Ukemi übergehen müssen. Sehr schnell stellt
sich Erschöpfung ein. Weil die Angriffe so unklar werden (Nage bietet
kein klares Ziel an) sind diese für den Nage keine Orientierung mehr
für seine Technikwahl. Auch die Uke haben kaum Orientierung und
Zeit zur Angriffswahl. Nage verliert die Möglichkeit, die
Angreifer zu steuern und zu entschleunigen, weil sie nun schnell
„irgendwas“ Improvisiertes, Unvollendetes und spät zu
Erkennendes machen. Entgegen der prinzipiellen Einstellung des Aikido,
vorwiegend in „Nachhand“ zu sein, dominiert nun Aktion
(„Vorhand“) vor Reaktion.
Ein grundsätzliches Problem bei mehreren Angreifern: irgendwann
erwischen sie einen immer, ganz besonders wenn sie es darauf anlegen und
den Nage „jagen“. Es ist unvermeidlich, daß man sich bei
einer Ausweichbewegung, bei einem Wurf oder einer Drehung „im
Fluß“ mal ganz ungünstig zu einem weiteren Angreifer
positioniert, der nur gerade dafür gewartet hat. Das Reaktions-Timing
kann dann einfach nicht mehr passen. Das sollte man akzeptieren und (mit
sich selbst) fehlertolerant sein.
EINE LÖSUNG:
Eine mögliche Lösung: Man muß es aushalten können, „zu
spät“ zu sein, in der Gewissheit, über genügend kurze (und auch
statische) Varianten zu verfügen, um auch mit einem „zu
spät“ (also in der Nachhand) noch etwas anzufangen. Immerhin hat
sich in dieser späten Situation die Angriffslage schon gut geklärt.
Dann helfen ganz allgemeine Kenntnisse und Einsichten – zu z.B.
Elastizität und (Un-) Gleichgewicht, (kleinteiliger) Bewegungsdynamik
und Körpermechanik, Freiheitsgraden und Hebelarten (Gelenke), Energie
und Kraft (-richtung, -wirkung, -fluß), nachträglich guter
Positionierung, und Prinzipien
(lever, plain, wedge, screw, wave, pulse).
Gleichzeitig müssen die angemessenen Varianten auch abrufbar sein.
Letztlich ist das („was noch geht“) eine leider kaum
abkürzbare Sache der Erfahrung und Übung. Dann kann man im Randori die
gelernten Muster mit kürzeren Technikversionen und größerer
(Umschalt-) Technikvielfalt anwenden. „Erwischt“ und
gegriffen zu werden, weit abseits vom Optimum, ist noch längst nicht
das Ende. Erst das Wissen um weitere Möglichkeiten (wirksame Standards,
“Defaults”, “No-Brainer”,
“Last-Ditch”) in schlechter Haltung, Situation und
Verfassung bringt die nötige Ruhe.
 Über Grenzen
Über Grenzen
Jede Kampfkunst hat Grenzen, ist auf je eigene Weise begrenzt. Dies
erstmal so dahin gesagt soll ein Anstoß sein. Ist man sich der Grenzen
bewußt, oder macht sie sich im Laufe seines KK-Werdegangs
irgendwann bewußt – vielleicht gezwungenermaßen
– dann werden die Erkenntnisse der Grenzen zu einer
Entscheidung: für oder gegen diese Kampfkunst, für oder gegen
ihre „Erweiterung“ mit (Stil-) Elementen anderer
Kampfkünste (Schulen/Stile), für oder gegen parallel geübte
Kampfkünste.
Es stellt sich die Frage, was man „eigentlich“ will.
Kämpfen können? Wenn ja, welche „Kämpfe“, für
oder gegen wen oder was und wie lange? Die eigene Kampfkunst sollte
zu einem selbst passen wie ein Lieblingskleidungsstück, in
dem man täglich herumlümmelt und es kaum spürt, das aber eben immer
„da“ ist. Sonst wird das nichts werden (mit der Übung), sie
wird nichts nützen (in der Wirkung), sie wird nicht wie
selbstverständlich verfügbar sein. Also sollte jeder i~wann
mal seine KK-Jacke passend für sich ausbeulen oder festschnüren.
Wenn die Kampfkunst passt, dann passen auch ihre Grenzen, sind
vielleicht gerade das, was sie für mich passend (also „in
Grenzen“ geübt und wirksam) macht.
- Begrenzte Situation
- ...
- Begrenzte Wirkung, Wirksamkeit
-
Wirksamkeit liegt in der Summe allen (Kampfkunst-) Könnens, nicht in einzelnen Techniken.
Wäre eine Technik in allen Situationen und unter allen Umständen wirksam, hätte sie sich längst in allen Kampfkünsten (und Wettkämpfen) durchgesetzt.
Ist die Wirkung weniger gefährlich, ist auch die Hemmung geringer sie anzuwenden. Man muß nicht erst auf gefährliche Angriffe warten, um angemessen zu reagieren.
- Begrenzte Haltung
- ...
- Begrenzte Initiative
- ...
- Begrenzte Athletik, Kondition, Reaktion
- ...
- KK ≠ SV
- ...
Meine Kampfkunst arbeitet mit Furcht und Schrecken. Das heißt, ich
erschrecke und ich fürchte mich, bin unachtsam und zerstreut,
vielleicht erschöpft oder verletzt, wenig(er) beweglich – und die
Kampfkunst soll trotzdem funktionieren und mich wenigstens
„retten“. Ohne daß ich vorher eine vorbereitete
äußere oder innere Haltung annehmen muß oder sogar ständig haben
sollte, immer „bereit“ und aufmerksam, gesammelt statt
zerstreut. Ohne daß ich auf bestimmte Bedingungen, auf (hohe) geistige
oder körperliche Leistungsfähigkeit angewiesen bin.
Reaktions- und Bewegungsmuster sollen möglichst
voraussetzungs- und ansatzlos ablaufen, gerade wenn das
Denken (das „Mentale“) schon aussetzt oder nicht mal
angefangen hat. Der Angst- oder Schreckreflex sei die erste Vorbereitung
und Aufnahme, die Parade als (Vor-)Teil der Riposte,
der „fertigen Antwort“. Die erste (Schutz-)Bewegung führe aus der
Erstarrung in bekannte Muster, in eine vorteilhafte(re) Position,
 AAM – “Alternative Aiki-Moves”
AAM – “Alternative Aiki-Moves”
Gote-Aikido (Gote = Nachhand, Sente = Vorhand, im
Go-Spiel) könnte ich/man es nennen. Es ist aber doch sowieso
das Aikido-Prinzip, oder? Kampfkunst für „zu
spät“, für unentschlossen bis zum Schluß und trotzdem
davonkommen, ohne Kampf-Botschaft und Kampf-Pose/Aura (in Gestik, Mimik,
Habitus). Ohne (korrekten) Abstand, ohne (korrekte) Haltung, ohne
besondere Achtung, Aufmerksamkeit oder Atmung,
sondern „einfach so“, möglichst voraussetzungslos.
Nicht Aikido erweitern, sondern für Aikido anpassen und nutzbar machen,
und dadurch das Reaktionsspektrum erweitern. Für einen Gewinn an
Ruhe und Gelassenheit durch Kenntnis weiter Möglichkeiten
(für Aikido) unter „suboptimalen“ fehlerhaften
Bedingungen. Für mehr Fehlertoleranz in Techniken, Abständen und
Haltungen.
Die Kampfkunst-Idee im Hintergrund (aus russischen KK/RMA-Quellen,
Kadochnikov z.B.): es geht um Koordination und Bewegungsmuster
zur Aufnahme waffenloser Angriffe im Nahbereich. Dazu soll
nicht die ganze Körpermasse mit(weg)bewegt – Sabaki/Tenkan
bewegen zuviel Masse und sind da nicht schnell genug – sondern nur
„in sich“ zur Ebene rotiert werden. Kombiniert mit den
Bewegungen der entspannten Arme, die sich „natürlich“ aus
der Hüft-Rotation ergeben. Dies nur eine der Grund-Annahmen.
Ich will mein Aikido nicht groß verändern oder ausbauen, sondern an
notorischen Panik-Punkten – wo man immer wieder einen Eindruck von
Unsicherheit, Unwirksamkeit oder Unzufriedenheit hat – einige
„Planken und Streben“ (Bewegungsmuster, Rettungsreflexe, halbe zweite
Chance nach erstem Murks) einziehen. In der Absicht oder Hoffnung, daß
das mental und physisch entspannter weil fehlertoleranter macht, mit
Verbesserungen für „das Ganze“ des Standard-Aikido. In
Momenten und Situationen Aikido noch möglich machen/halten, wo es
klassisch schon zu spät, zu nah, zu schwach, zu unaufmerksam, zu
haltungsfalsch, zu ungeklärt ist/war.
Die Formenstrenge, die in japanische Kampfkünste gerne eingebaut ist,
mit der sie „überbaut“ sind, als Bedingung und
Forderungsbündel („so geht es“), erzeugt einen Druck, der
nicht immer zielführend ist. Ich suche nach anderen Lösungen –
und nenne das Projekt erstmal AAM (“Alternative
Aiki-Moves”), statt MMA.
copyleft &c
|
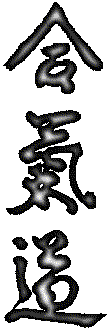
 Fukuzawa Yukichi (25, 1835–1901) mit Theodora Alice Shew (12, 1848–1904)
Fukuzawa Yukichi (25, 1835–1901) mit Theodora Alice Shew (12, 1848–1904)